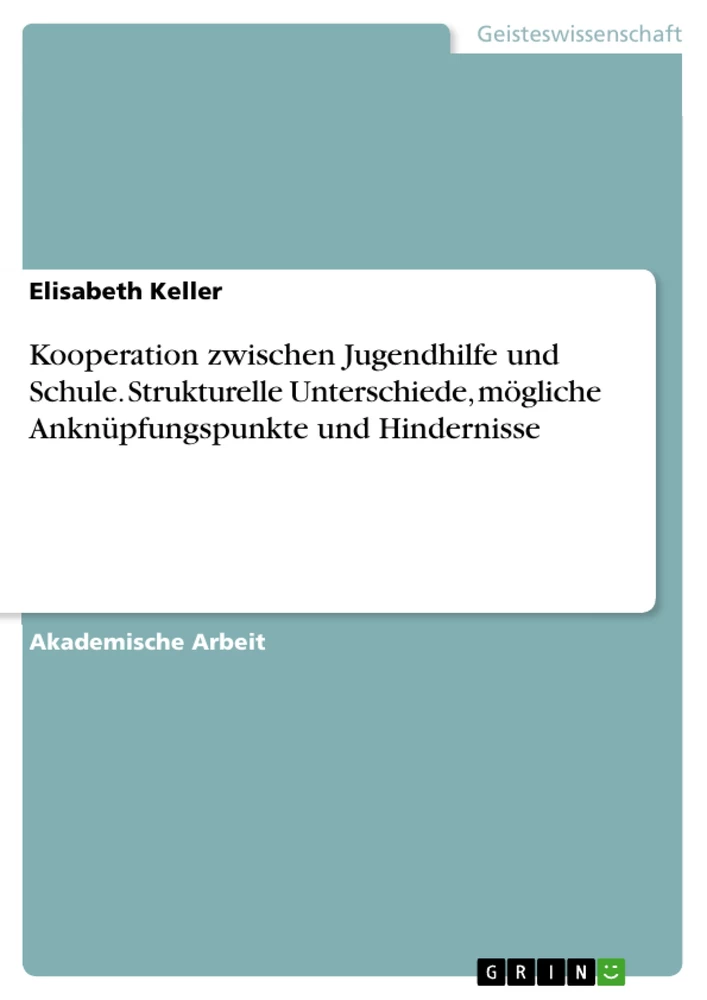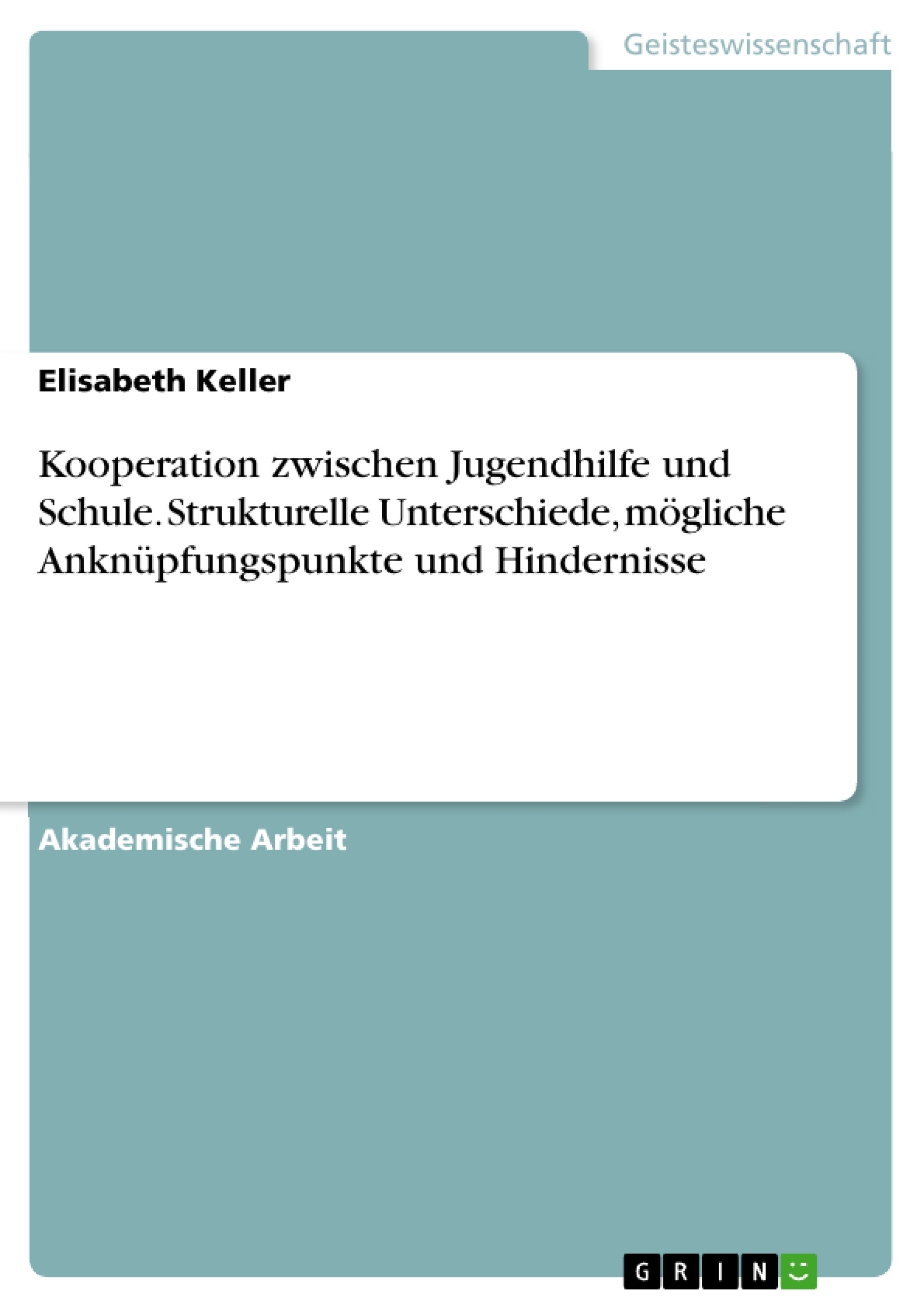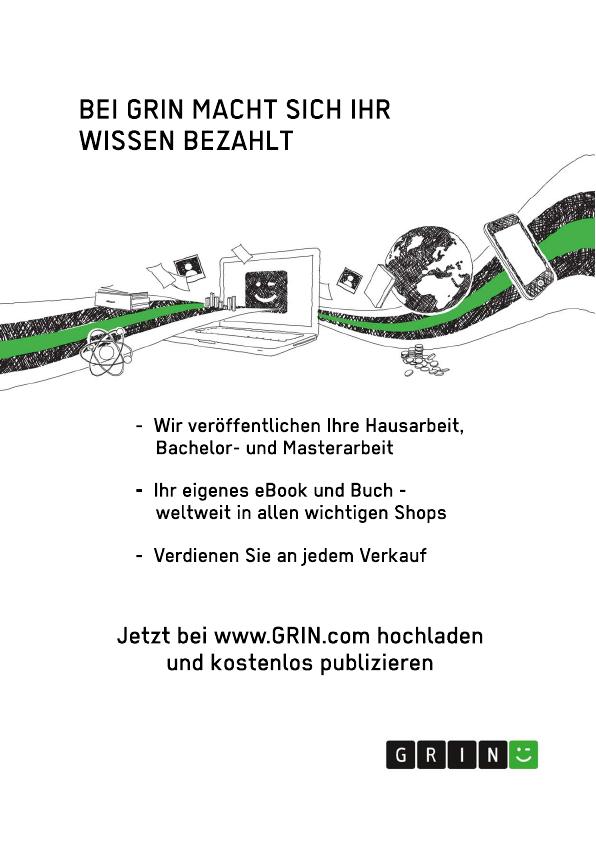Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe wird von vielen Faktoren beeinflusst und gelenkt. Im Folgenden sollen die strukturellen Unterschiede, mögliche Anknüpfungspunkte und Hindernisse, unterschiedliche Kooperationsverhältnisse und zum Schluss auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen sowie die Rolle der Familie in diesem Prozess betrachtet werden.
Durch die „pädagogische Not“ (Mühlum 1993, S. 266) sind die drei Sozialisationsinstanzen Schule, Jugendhilfe und Familie zu einer langfristigen Zusammenarbeit aufgefordert. Eine mögliche und sehr vielversprechende Form dieser Zusammenarbeit stellt die Schulsozialarbeit dar, deren Wirksamkeit durch zahlreiche positive Ergebnisse aus den bereits an vielen Schulen durchgeführten Projekten belegt wurde. Schule und die Jugendhilfe stehen vor der Herausforderung eine tragfähige Kooperationsbeziehung am Ort der Schule aufzubauen. Die vielen neuen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, stehen jedoch auch vielen Stolpersteinen und Schwierigkeiten gegenüber, die noch überwunden werden müssen.
Inhalt
1 Jugendhilfe und Schule: Strukturelle Unterschiede
2 Anknüpfungspunkte und Hindernisse
3 Mögliche Kooperationsverhältnisse
3.1 Organisationsmodelle zur Umsetzung von Schulsozialarbeit
3.1.1 Integrations- und Subordinationsmodell
3.1.2 Distanzmodell
3.1.3 Kooperationsmodell
3.2 Formen der Trägerschaft
3.2.1 Freier Träger
3.2.2 Schule als Träger
3.2.3 Behörde als Träger
3.3 Ebenen der Kooperation
4 Voraussetzungen erfolgreicher Kooperation
4.1 Erforderliche Rahmenbedingungen
4.1.1 Aufgaben der Jugendhilfe
4.1.2 Aufgaben der Schule
4.1.3 Aufgaben der Jugendhilfe und Schule
4.2 Prinzipien gelingender Kooperationsprozesse
5 Beteiligungsmöglichkeiten der Familie
5.1 Informiertheit der Eltern über Schulsozialarbeit
5.2 Familienorientierte Schülerhilfe
7 Anhang
8 Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)