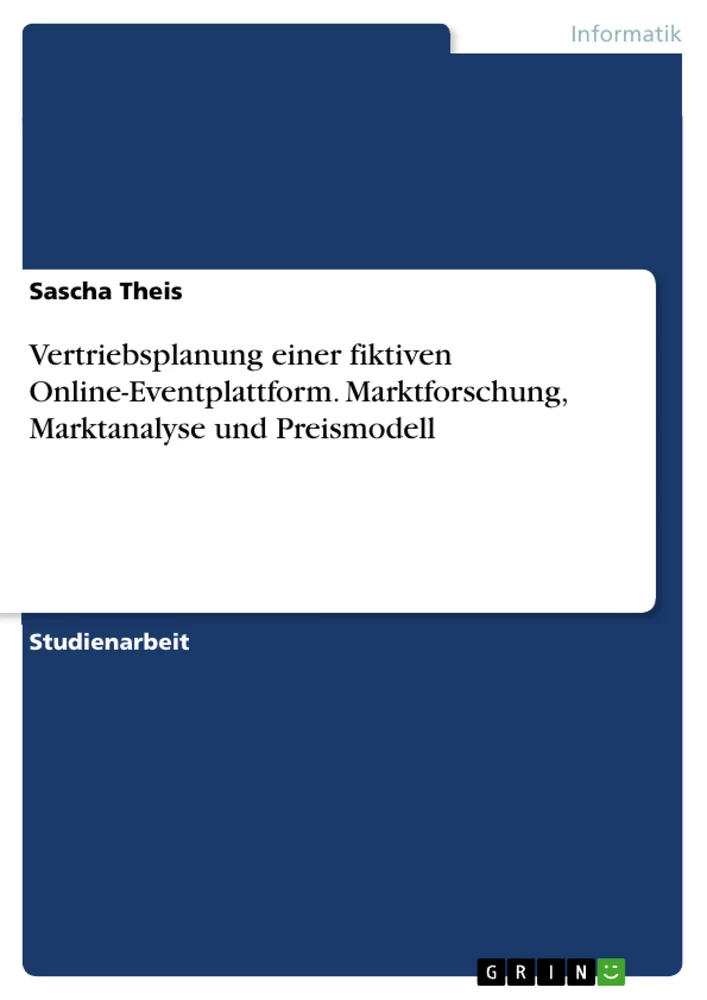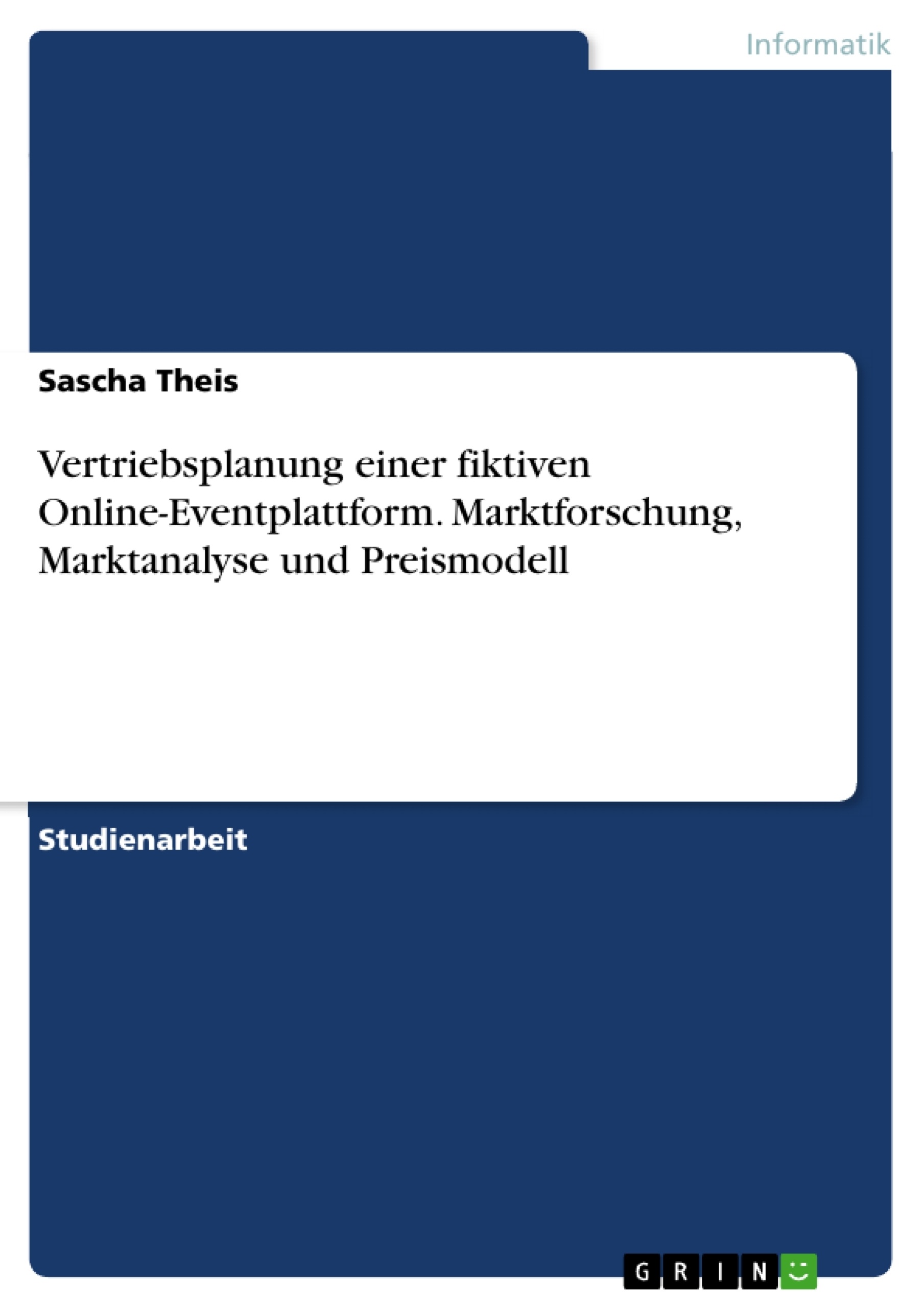Die Studenten des Studiengangs "Betriebswirtschaftslehre und IT" des Jahrganges 2011 konzipierten im Rahmen ihres Studiums an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik eine internetbasierte Geschäftsidee mit dem Projektnamen "Veranstaltungsheld".
Die Schaffung einer Plattform, welche es ermöglicht einfach verschiedenste Arten von Veranstaltungen zu finden, wurde als Ziel definiert.
Dabei sollten insbesondere regionale Veranstaltungen im Fokus stehen. Die technischen Aspekte dieser Geschäftsidee sind wohl theoretisch erarbeitet, wie auch bereits in Form einer Webseite praktisch umgesetzt worden.
Aufgrund der bisherigen Fokussierung auf die Technik wurden die betriebswirtschaftlichen Aspekte bewusst vernachlässigt.
Die Problemstellung dieser Hausarbeit ergibt sich aus dem vorgegebenen Anspruch eines durchdachten Geschäftsmodells.
Dieser bedingt auch die Betrachtung vertrieblicher Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Ziel und Aufbau
2. Begriffsdefinitionen
2.1. Erlösquelle, Erlösform und Erlösmodell
2.2. Preispolitik und Preisfindung
2.3. Marktanalyse
2.4. Zweiseitige Märkte
3. Geschäftsidee
3.1. Angebot
3.2. Kunden
3.3. Funktionalität und Integration
3.4. Interessenorientierung
3.5. Kosten
4. Marktanalyse
4.1. Größe und Struktur des Zielmarktes
4.1.1. Veranstalter und Veranstaltungen
4.1.2. Veranstaltungsnachfrager
4.1.3. Werbekunden
4.2. Vertikalanalyse
4.3. Horizontalanalyse
4.3.1. überregionalen Veranstaltungsportale
4.3.2. regionale Veranstaltungsportale
4.4. Bewertung der Analyseergebnisse
5. Erlösmodell und Preispolitik
5.1. Erlösquellen
5.2. Erlösformen
5.3. Erlösmodell
5.4. Preispolitik
6. Zusammenfassung und Ausblick
Inhaltsverzeichnis
Literatur
Verzeichnisse