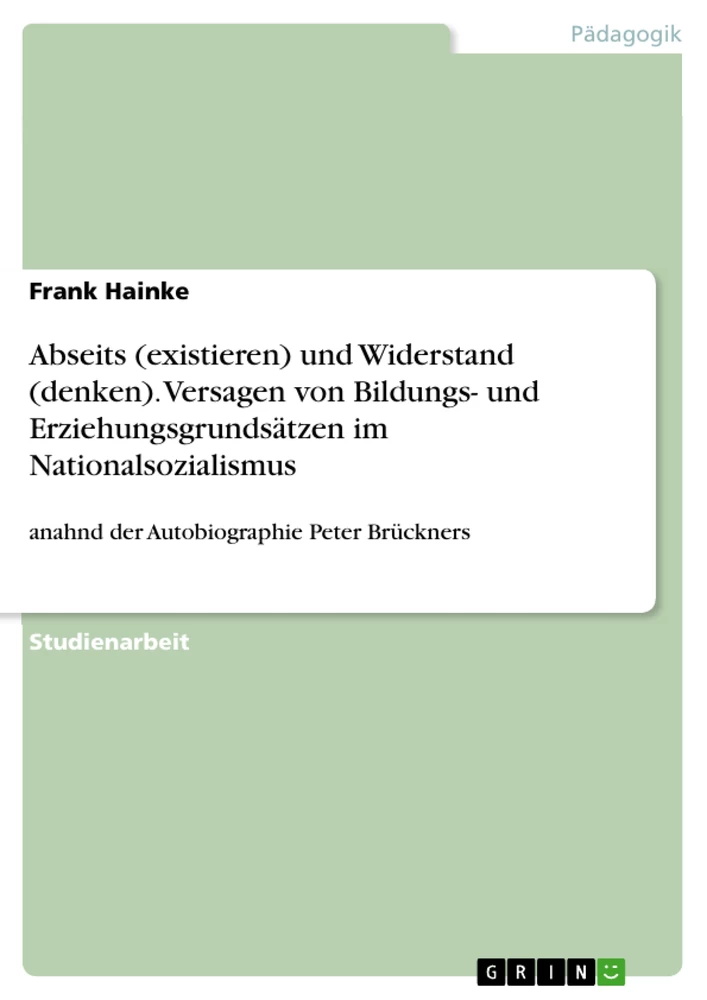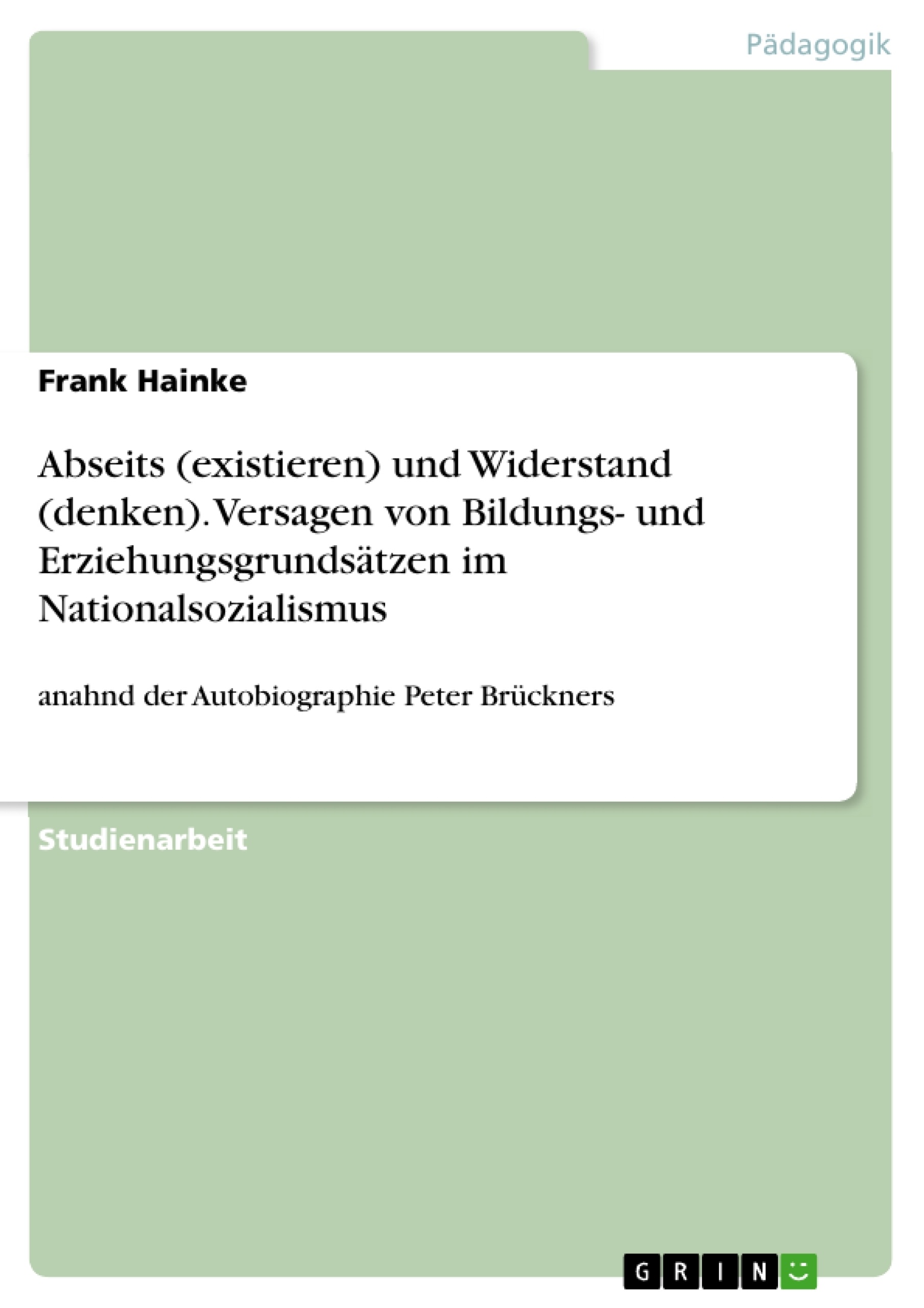„Hier ist das jüngste Deutschland der Reinen und Reifenden, hier ist unsere Zukunft und unser Schicksal“, schrieb 1934 der Reichsjugendführer Baldur von Schirach in einem Geleitwort zu Heinrich Hoffmans Bildband „Jugend um Hitler“. In dessen Zuge beschwor er die völlige Ergebung einer nationalsozialistischen Jugend zu Adolf Hitler. So folgerte von Schirach weiter, dass „[...] hier noch ein anderes [ist], das kein Gesetz befehlen, kein Staatsmann kommandieren kann: die Liebe der Jugend. Kein Deutscher hat in solchem Ausmaß die Jugend wirklich besessen wie der Führer.“
Der umfassende Besitzanspruch der in diesen Worten zum Ausdruck kommt, gehört zu den greifbarsten Charakteristika des Nationalsozialismus, dem sich die deutsche Jugendgeneration der Zwanziger und Dreißiger Jahre ausgesetzt sah. Einer dieser Jugendlichen war Peter Brückner. Dessen Autobiographie ‚Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 1933 und 1945‘ schildert den zunehmenden Zugriff des Regimes in die Bildung und in weite Lebensbereiche der Jugendlichen, sowie die vereinzelten Versuche sich diesem Zugriff zu entziehen.
„Wie bildet sich ein Antifaschist im Wildwuchs [...]“ fragte Brückner rückblickend, und „[…] wie wird aus ihm später eine politische Existenz?“ Diese spezielle politische Existenz ist im Bezug zu Peter Brückner eine Kernfrage, die den Hintergrund, die Intention und den Zweck seiner Autobiographie erhellt.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Autobiographie als Quelle für den Nationalsozialismus
3. Peter Brückner zwischen Nationalsozialismus und Deutschem Herbst
3.1. Der Staats- und Systemkritiker
3.2. Aufbau und Struktur der Autobiographie Brückners
4. Das Abseits als sicherer Ort
5. Ergebnisse und Fazit der Untersuchung
6. Literaturverzeichnis