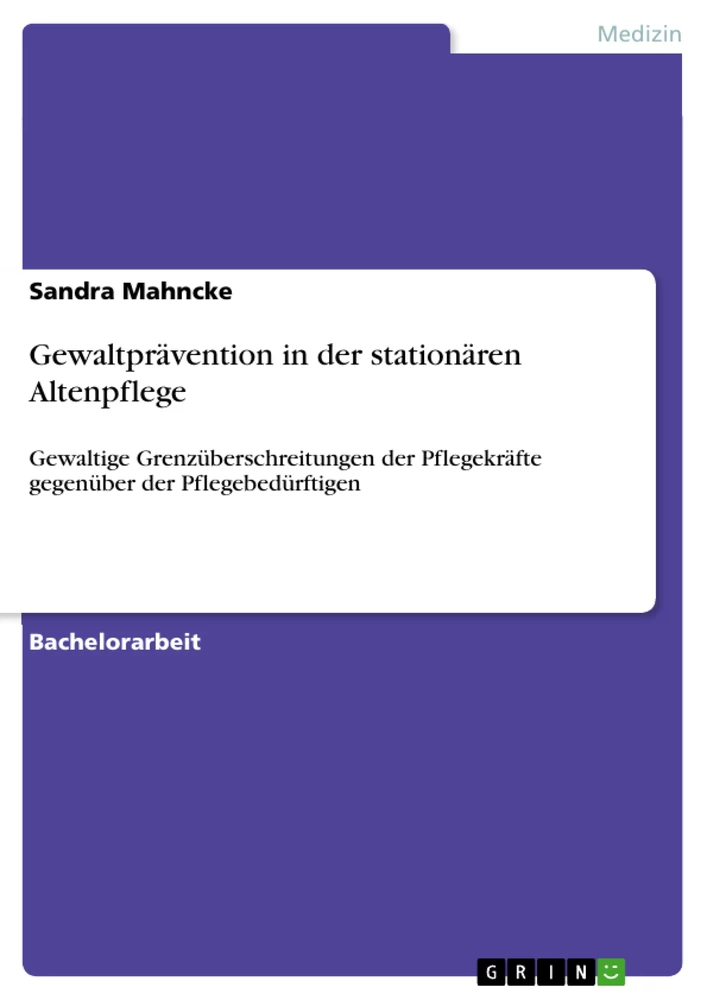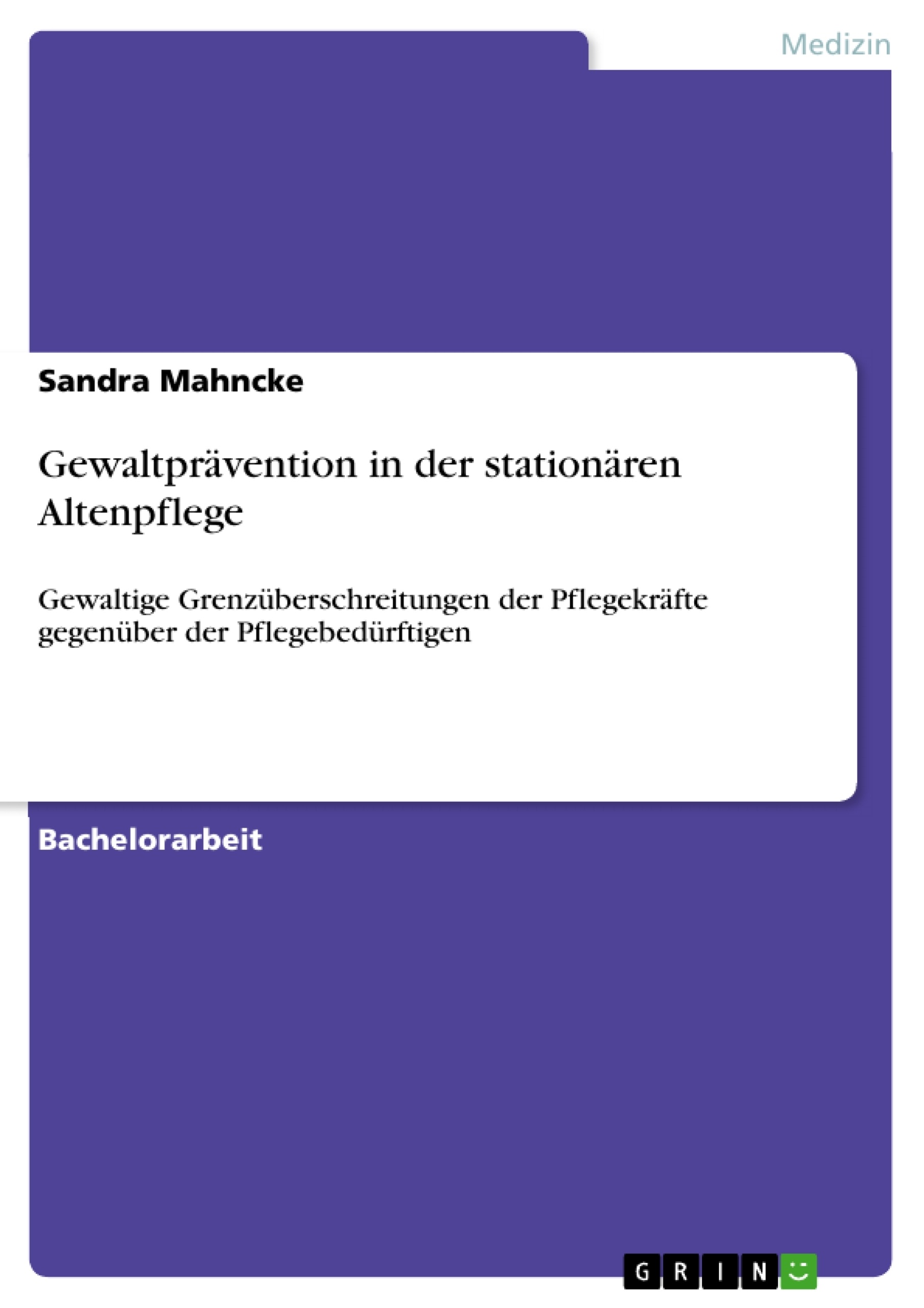Ich möchte mit dieser Arbeit zeigen, wie Gewalt und Aggressionen in der stationären Altenpflege durch Mitarbeiter gegenüber Pflegebedürftigen entgegengewirkt werden kann und durch welche Anzeichen gewaltbereite Mitarbeiter frühzeitig erkannt werden können. Weiterhin möchte ich die Begriffe Gewalt und Aggressionen erläutern und welche Gewalt- und Aggressionsformen es überhaupt gibt.
Daraufhin stellte ich mir die Frage, welche Gründe, Ursachen und Auslöser zu Gewalt und Aggression gegenüber Schutzbefohlenen führen und durch welche Erscheinungsbilder Gewalt auftreten kann. Innerhalb meiner Literaturrecherche war ich auf der Suche nach Medienberichten über Gewalt in der stationären Altenpflege. Aufgrund der geringen Anzahl an Berichterstattungen stieg mein Interesse erneut an und führte zu weiteren Fragen.
Wird über Gewalt im Bereich der stationären Altenpflege kommuniziert oder ist es ein Tabuthema? Ab wann beginnt Gewalt? Wie weit muss ein Gewaltakt vollzogen werden, damit die Öffentlichkeit darüber spricht? Führen die hohen Anforderungen der Mitarbeiter und der ständige Personalmangel zu Gewalteinwirkungen gegenüber den Pflegebedürftigen? Wie kann Gewalt, durch Pflegepersonal ausgeübt, verhindert werden? Ist ein Konzept der Gewaltprävention in stationären Einrichtungen hilfreich?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Gewalt?
2.1 Gewaltformen gegen Pflegebedürftige
2.2 Personale/direkte Gewalt
2.2.1 Körperliche Gewalt
2.2.2 Psychische Gewalt
2.2.3 Finanzielle Ausbeutung
2.2.4 Einschränkung des freien Willens
2.2.5 Vernachlässigung
2.3 Strukturelle Gewalt
2.4 Kulturelle Gewalt
3. Was sind Aggressionen?
3.1 Physische Aggressionsform
3.2 Non-verbale Aggressionsform
3.3 Verbale Aggressionsform
4. Zahlen, Daten, Fakten – Gewalt gegen Pflegebedürftige
5. Gründe, Ursachen und Auslöser von Gewalt und Aggressionen gegenüber der Pflegebedürftigen
5.1 Überforderung der Pflegekräfte durch die strukturellen Begebenheiten
5.2 Frustration der Pflegekräfte durch die hierarchische Rangordnung
5.3 Überforderung der Pflegekräfte durch die Pflegebedürftigen
5.4 Überforderung der Pflegekräfte durch private Einflussfaktoren
5.5 Frustration der Pflegekräfte durch zu geringes Einkommen
5.6 Burnout der Pflegekräfte
6. Prävention und Lösungsansätze gegen Gewalt und Aggressionen an Pflegebedürftigen
6.1 Lösungsansätze aus betrieblicher Sicht
6.1.1 Fortbildungsangebote, Coaching und Weiterbildungen
6.1.2 Supervision
6.1.3 Jahresmitarbeitergespräche
6.1.4 personale Strukturen
6.1.5 räumliche Strukturen
6.1.6 Handlungsspielräume
6.1.7 Mitarbeiterbesprechungen
6.1.8 Belohnung der Mitarbeiter
6.2 Lösungsansätze aus privater Sicht
6.2.1 Selbsthilfegruppen
6.2.2 Familienberatung
6.2.3 Entwicklung persönlicher Entlastungsstrategien
6.2.4 Bewältigung von Burnout
6.2.5 Umgang mit Aggressionen
6.3 Lösungsansätze aus behördlicher Sicht
6.3.1 Medizinischer Dienst der Krankenkassen
6.3.2 Wohn- und Pflege-Aufsicht
7. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Internetquellen