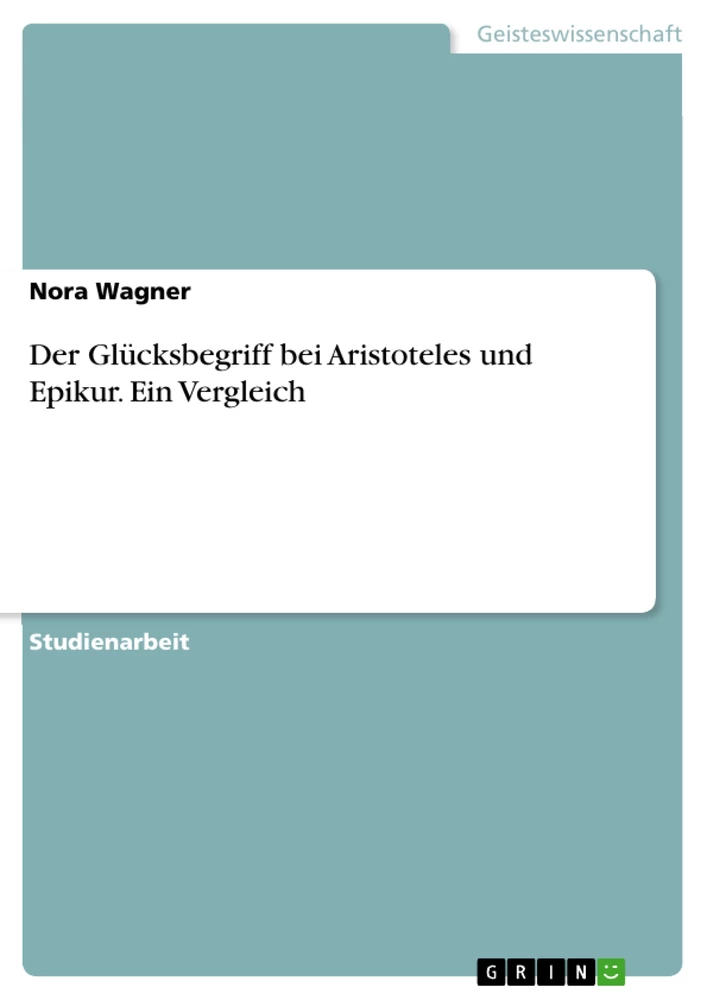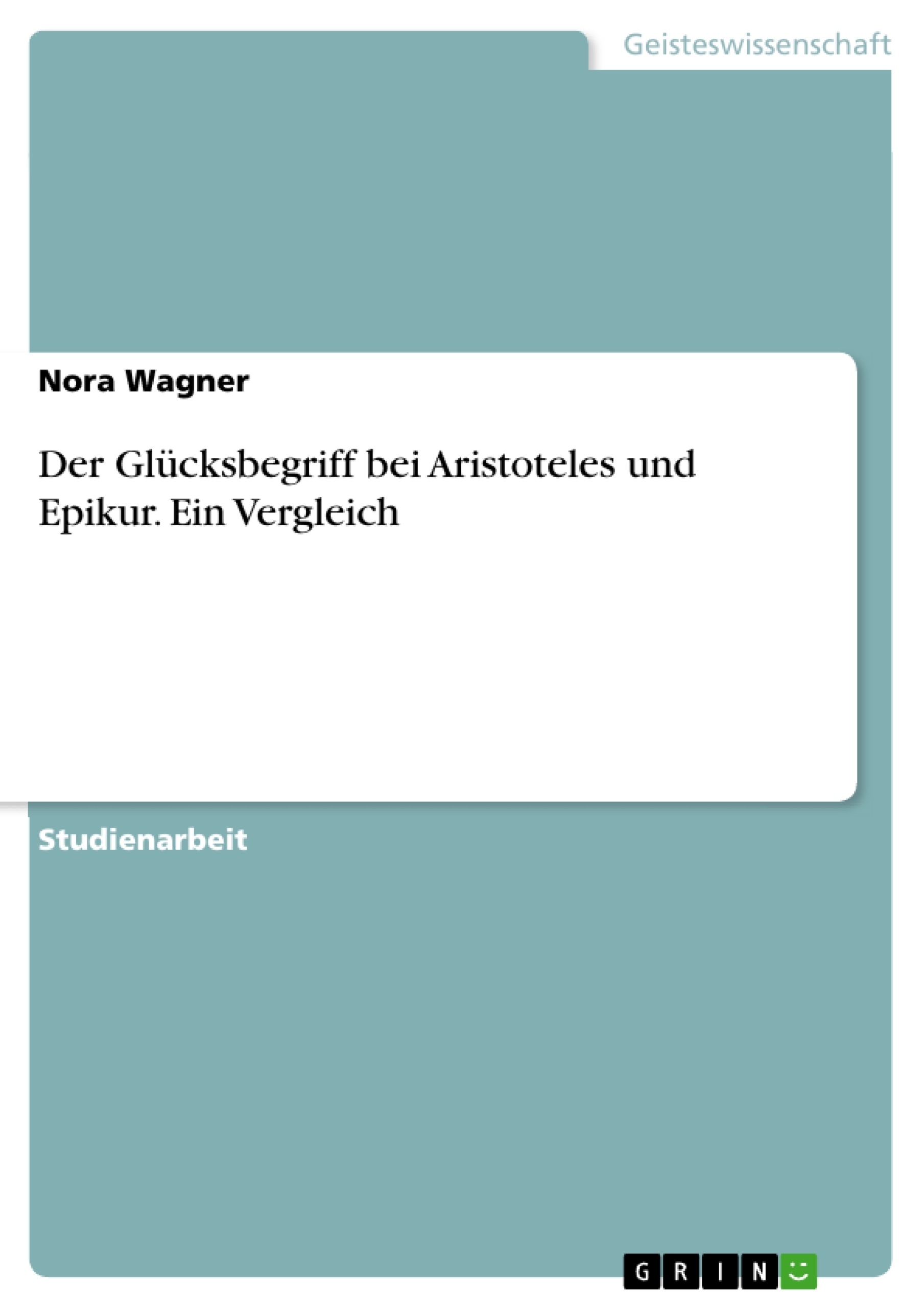Was ist Glück und ist es Zufall, dass manche Menschen trotz schlechter Lebensumstände glücklicher sind als die, die im Überfluss zu leben scheinen? Das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit selbst. Früher wie auch heute ist es das höchste Ziel des Menschen ein glückliches Leben zu führen. Doch was genau ist Glück und woher kommt es? In unserem Sprachgebrauch wird der Begriff des Glückes meist dazu verwendet um positive Emotionen auszudrücken. Doch im Grunde genommen wird der Begriff des Glücks subjektiv gemessen und bedeutet für jeden etwas anderes. Während der eine mit Reichtum wahres Glück assoziiert, ist es für den nächsten die Freiheit tun und machen zu können was er möchte. Für den Kranken ist das Glück die Gesundheit und für den Gefangenen die Freiheit. Unbestreitbar jedoch ist: ,,Alle Menschen wollen glücklich sein.“ Bereits in der Antike beschäftigten sich die Philosophen mit Fragen wie, was Glückseligkeit überhaupt sei und wie man diese erlangen konnte. Aristoteles greift einige Positionen seiner Vorgänger wie Platon und Euklid auf. Mit seiner Nikomachischen Ethik gelingt ihm ein Leitfaden, der dabei helfen soll sich auf die wahren Werte zu konzentrieren. Seine Schrift ist einen Wegweiser, der vor dem falschen Eifer schützen und veranschaulichen soll, wie zu Handeln sei um ein guter Mensch zu werden und ein glückliches Leben zu führen. Auch Epikur liefert eine Beschreibung des Glücks. Im Gegensatz zu Aristoteles liegt das Glück bei ihm jedoch nicht in der Handlung selbst sondern in der Lust.
In dieser Arbeit wird ein Vergleich zwischen dem Verhältnis von Glück und Lust bei Aristoteles und Epikur angestellt. Zunächst soll genauer betrachtet werden, inwiefern Aristoteles eine Theorie liefert um Glückseligkeit zu erlangen und was genau er unter ,,eudaimonia“ versteht. Da jedes menschliche Handeln auf etwas zielt, es also verschiedene erstrebte Güter gibt, werde ich zunächst den Unterschied zwischen diesen individuellen Gütern und dem höchsten Gut erläutern. Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich mich mit der Lust und Tugend bei Aristoteles befassen und untersuchen was diese beiden Komponenten für Epikur bedeuten. Anschließend werde ich die Glücksethiken der beiden Autoren vergleichen. Im Laufe dieses Vergleiches werden die Parallelen der beiden Denker prägnant sein.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Glückseligkeit in der Nikomachischen Ethik:
2.1. Glück als höchstes Gut
2.2. Handlungen und Güter:
2.3. Lust bei Aristoteles:
2.4. Das Ergon-Argument
3. Die Definition des Glücksbegriffes nach Epikur
3.1. Lust und Unlust
3.2. Tugend und Eudaimonia
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis