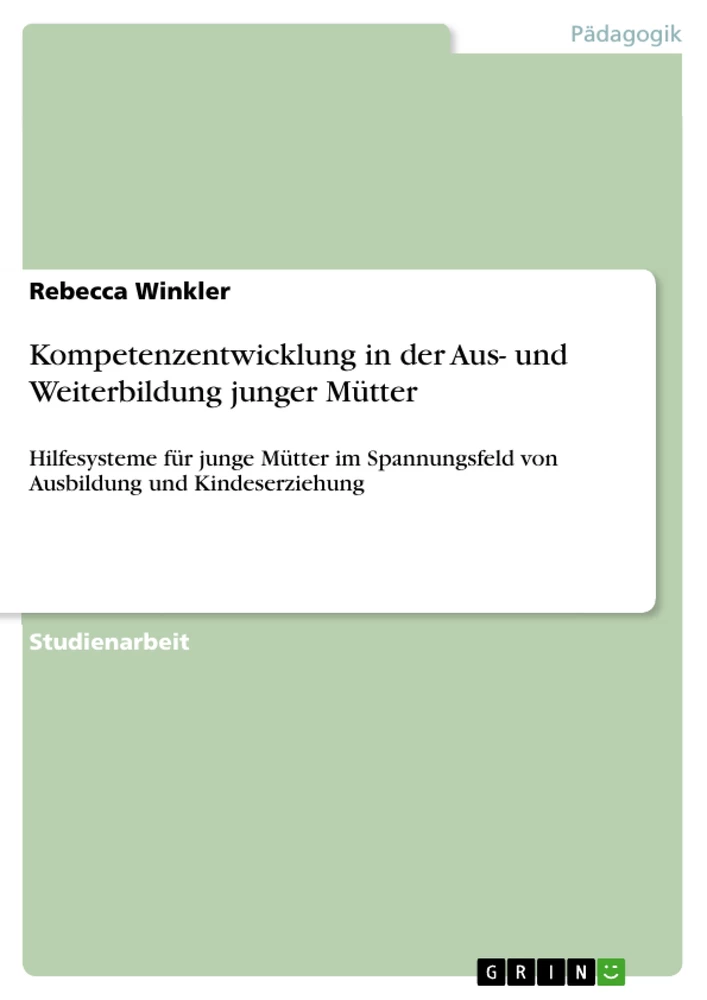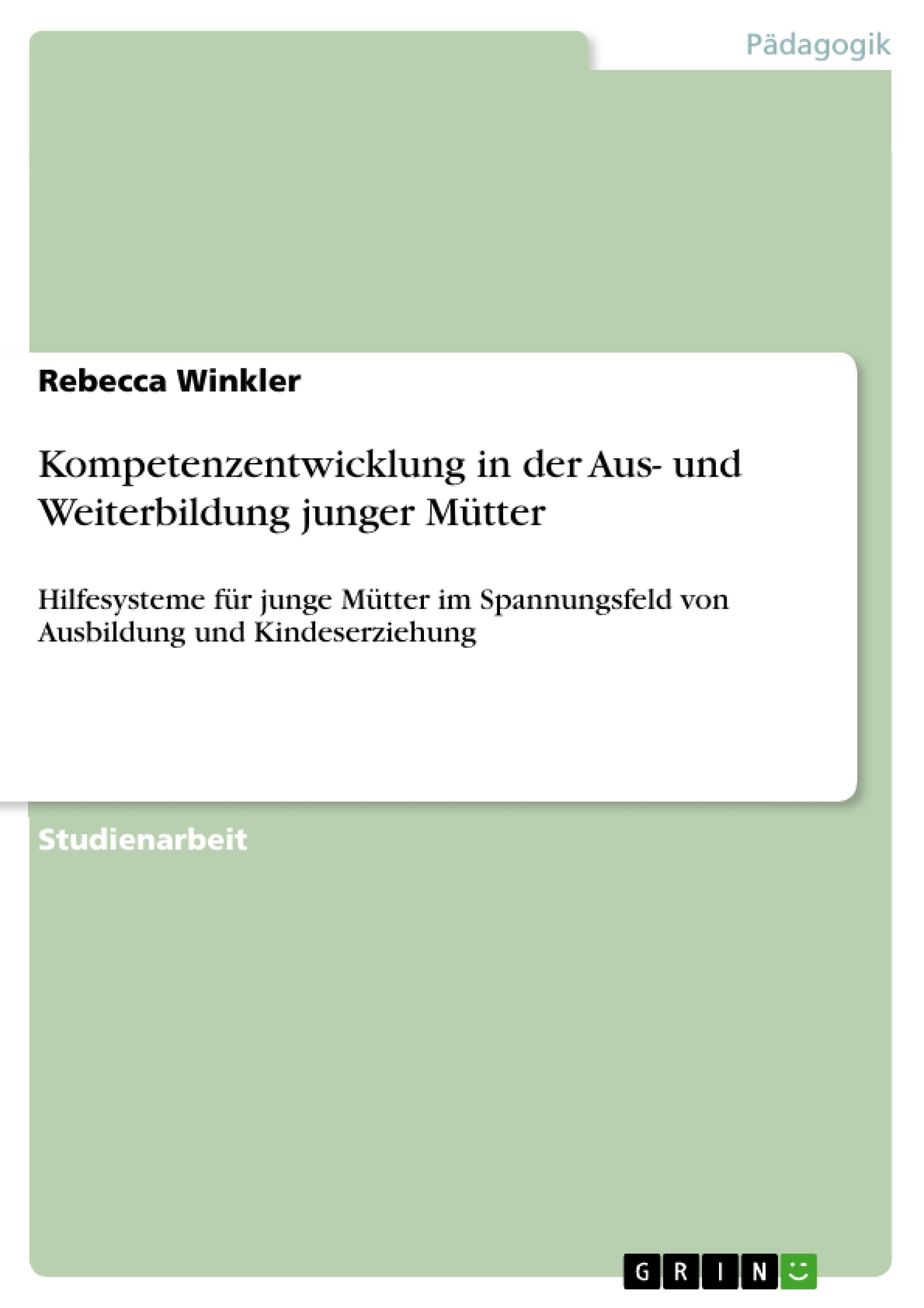Junge Mütter ohne abgeschlossene Berufsausbildung müssen oftmals eine Doppelrolle als Mutter und Auszubildende einnehmen. Sie gelten als Zielgruppe mit besonderem Förderbedarf, denn die Vereinbarung von Erziehung und Ausbildung setzt ein hohes Maß an Eigenverantwortung voraus. Aus berufspädagogischer Sicht wird die Zielgruppe bei den familienpolitischen Diskussionen zur Förderung von Familie und Beruf jedoch vernachlässigt, denn der Fokus liegt hierbei meist auf gut ausgebildete Frauen. Doch auch junge Mütter ohne Abschluss sind auf Förderprogramme angewiesen, um den Spagat zwischen Kindeserziehung und Ausbildung zu meistern.
In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, welche Hilfesysteme in Deutschland für junge Mütter existieren und wie die Eingliederung in die Berufswelt für die beschriebene Zielgruppe gelingt. Im Fokus stehen dabei Projekte wie z.B. die Bremer Förderkette, die zur Kompetenzentwicklung junger Mütter beiträgt. Dabei wird zunächst die soziale Situation von jungen Müttern unter 25 Jahren in Deutschland betrachtet und wie sich die Anzahl der Geburten und Schwangerschaftsabbrüche in den letzten Jahren entwickelte. Es folgt eine Darstellung der Chancen für junge Frauen, die trotz Mutterschaft eine Ausbildung in Form einer Teilzeitberufsausbildung durchführen. Daraufhin werden Projekte zur Unterstützung der Zielgruppe beschrieben und anhand einer Einschätzung wird erläutert, wie die Umsetzung in der Praxis gelingt. Es folgt eine Aufschlüsselung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten und eine Beschreibung der aktuellen Situation der Kinderbetreuung.
In der Kritik werden die Konzepte für die so genannten Teenie-Mütter hinterfragt und betrachtet. Es wird herausgestellt, ob durch die benannten Hilfesysteme eine Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung gelingen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition der Zielgruppe junger Mütter
3. Soziale Situation der jungen Mütter
3.1 Bildungsstand
3.2 Statistik Sozialhilfebezug
3.3 Geburtenentwicklung/ Schwangerschaftsabbrüche - Zwischenfazit
4. Hilfesysteme zur Vereinbarung von Ausbildung und Kindeserziehung
4.1 Betriebliche Ausbildung in Teilzeit
4.2 Projekte
4.3.1 Bremer Förderkette
4.3.2 MiA ViA
4.3 Einschätzungen der Teilzeitausbildung aus Sicht des Trägers und der Teilnehmer
4.4 Finanzielle Förderung
4.5 Kinderbetreuung
5. Kritik
6. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Junge Mütter ohne abgeschlossene Berufsausbildung müssen oftmals eine Dop- pelrolle als Mutter und Auszubildende einnehmen. Sie gelten als Zielgruppe mit besonderem Förderbedarf, denn die Vereinbarung von Erziehung und Ausbildung setzt ein hohes Maß an Eigenverantwortung voraus. Aus berufspädagogischer Sicht wird die Zielgruppe bei den familienpolitischen Diskussionen zur Förderung von Familie und Beruf jedoch vernachlässigt, denn der Fokus liegt hierbei meist auf gut ausgebildete Frauen. Doch auch junge Mütter ohne Abschluss sind auf Förderprogramme angewiesen, um den Spagat zwischen Kindeserziehung und Ausbildung zu meistern.
In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, welche Hilfesysteme in Deutschland für junge Mütter existieren und wie die Eingliederung in die Berufs- welt für die beschriebene Zielgruppe gelingt. Im Fokus stehen dabei Projekte wie z.B. die Bremer Förderkette, die zur Kompetenzentwicklung junger Mütter bei- trägt. Dabei wird zunächst die soziale Situation von jungen Müttern unter 25 Jah- ren in Deutschland betrachtet und wie sich die Anzahl der Geburten und Schwan- gerschaftsabbrüche in den letzten Jahren entwickelte. Es folgt eine Darstellung der Chancen für junge Frauen, die trotz Mutterschaft eine Ausbildung in Form einer Teilzeitberufsausbildung durchführen. Daraufhin werden Projekte zur Unterstüt- zung der Zielgruppe beschrieben und anhand einer Einschätzung wird erläutert, wie die Umsetzung in der Praxis gelingt. Es folgt eine Aufschlüsselung der finan- ziellen Förderungsmöglichkeiten und eine Beschreibung der aktuellen Situation der Kinderbetreuung.
In der Kritik werden die Konzepte für die so genannten Teenie-Mütter hinterfragt und betrachtet. Es wird herausgestellt, ob durch die benannten Hilfesysteme eine Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung gelingen kann.
2. Definition der Zielgruppe junger Mütter
Der Begriff junge Mütter bezieht sich in dieser Hausarbeit auf Mütter unter 25 Jahren, die bisher noch keine Schul- oder Berufsausbildung abgeschlossen haben. Diese Zielgruppe hat einen erschwerten Zugang zum deutschen Berufsbildungssystem, da das übliche 3-Phasen Modell: Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Familiengründung hier nicht greift (Anslinger 2009, S.11).
3. Soziale Situation der jungen Mütter
Die Zielgruppe junger Mütter lässt sich durch unterschiedliche Lebenslagen, sozia- le Herkunft, Schul- und Ausbildungsabschlüsse charakterisieren (Anslinger 2009, S. 80) . Um eine Einordnung der Mütter im beruflichen Bildungssystem vornehmen zu können wird zunächst der Bildungsstand erhoben, sowie amtliche Statistiken hinsichtlich des Bezugs von staatlichen Transferleistungen betrachtet. Es folgt eine Aufschlüsselung der Geburtenentwicklung und Schwangerschaftsabbrüche der Teenie-Mütter. Die Zielgruppe kann nicht durchweg als Problemgruppe betrachtet werden, jedoch unterliegt sie einem hohen Verarmungsrisiko.
3.1 Bildungsstand
Im Jahr 20091 verfügten rund 57% der jungen Mütter über einen Haupt- oder Real- schulabschluss, oder sie besaßen weder einen Schulabschluss, noch einen berufli- chen Abschluss. Dementsprechend haben 6 von 10 jungen Müttern einen geringen Bildungsstand.
(https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2011/02/PD 11_068_122.html, Abruf am 12.05.2012) Im Jahr 2006 wurde festgestellt, dass 16% der jungen Mütter unter 25 Jahren kei- nen Schulabschluss erreicht hatten. Von den 77% die einen Schulabschluss er- reicht hatten erzielten 48% den Hauptschulabschluss, 5% die Polytechnische O- berschule und 20% die mittlere Reife. Nur 1% der jungen Mütter erlangte die Fachhochschulreife und lediglich 2% erzielten das Fachabitur. Bei der beruflichen Bildung zeigt sich ebenso ein alarmierendes Bild, drei Viertel der unter 25 jährigen besitzen keinen Berufsabschluss (vgl. Friese 2008, S. 51).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: (Quelle: Friese, 2008 eigene Grafik)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: (Quelle: Friese, 2008 eigene Grafik)
3.2. Sozialhilfebezug
Laut Statistiken des Bundesamts beantragten 14% der Mütter (15- 34 Jahre) Sozi- alhilfe, sowie weitere 8% Arbeitslosengeld zur Unterstützung ihrer finanziellen Situation. Der Hauptteil der Mütter bestreitet ihren Lebensunterhalt jedoch durch eigenes Erwerbseinkommen oder sie werden durch Unterhaltsleistungen des Part- ners oder anderer Angehöriger unterstützt. Bei den so genannten Teenie-Müttern unter 25 Jahren zeichnet sich jedoch ein völlig anderes Bild ab. Im Alter von 18 Jahren bezogen im Jahr 2000 fast 50% der jungen Mütter staatliche Transferleis- tungen. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Prozentsatz wieder ab.
Nur 19 % der unter 25 jährigen erzielten ein eigenes Einkommen. Diese Zielgruppe wird mit insgesamt 29% durch Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe unterstützt. Der größte Anteil der finanziellen Unterstützung erhalten sie mit 44% durch Unterhaltleistungen (vgl. Friese, 2008, S. 55).
3.3 Geburtenentwicklung und Schwangerschaftsabbrüche
Die Anzahl der Geburten in Deutschland geht seit 1964 drastisch zurück. Wurden im Jahr 1964 noch 1.357.304 Kinder geboren, schrumpfte diese Anzahl im Jahr 2004 auf 705.622. Zurückzuführen lässt sich dies unter anderem auf die Verbreitung der Anti-Baby-Pille (vgl. Friese 2008, S. 37).
Die Anzahl der Geburten von Müttern unter 20 Jahren stieg nach 1986 an, erreich- te aber nicht das Niveau von 1980. Nach der Wiedervereinigung blieb die Gebur- tenentwicklung der minderjährigen Mütter relativ gleich bleibend. Auch im weite- ren Verlauf ab dem Jahr 2000 ließ sich keine Anstieg der Teenagerschwanger- schaften verzeichnen. Von 705.622 geborenen Kindern im Jahr 2004 fielen 20,5% auf die Mütter unter 25 Jahren.
Trotz der konstanten Geburtenentwicklung der jungen Mütter, lässt sich ein starker Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche seit 1996 beobachten. Mädchen unter 15 Jahren brechen die Schwangerschaft häufiger ab, als dass die Kinder austragen werden (170 Geburten / 779 Abbrüche). Die 15- 17 jährigen werdenden Mütter beenden etwa zu 50% ihre Schwangerschaft durch Abbruch, während die 18- 19 jährigen nur noch ein Drittel der Kinder abtreiben. Bei den 20-24 jährigen Frauen wird jede fünfte Schwangerschaft abgebrochen (vgl. Friese 2008, S.38).
Zwischenfazit
Die soziale Situation der jungen Mütter zeigt ein alarmierendes Bild hinsichtlich der Integration in die Berufswelt. Die meisten jungen Frauen verfügen nur über einen geringen Schulabschluss und haben zu einem großen Teil keinen Berufsabschluss erreichen können. Dementsprechend haben sie auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkte Chancen auf eine gut bezahlte Arbeit. Wenn sie einen Job erhalten, dann ist dieser meist im Niedriglohnsektor angesiedelt. Junge Mütter benötigen allerdings eine gute Berufsausbildung und im Anschluss eine entsprechend entlohnte Arbeit, um die Anforderungen des familiären Lebens stemmen zu können. Daher ist ein Umdenken in der Politik gefragt, um Frauen auf ihrem Weg zwischen Ausbildung und Kindeserziehung zu unterstützen.
Insgesamt lässt sich eine besorgniserregende sozioökonomische Situation junger Mütter feststellen. Durch die geringen Abschlüsse können oft nur unterqualifizierte Erwerbstätigkeiten aufgenommen werden. Sie sind daher von Transferleistungen und Unterstützungssystemen abhängig.
Es lässt sich ein leichter Anstieg der Schwangerschaften bei minderjährigen Frau- en erkennen, allerdings tragen sie ihre Kinder seltener aus. Die gestiegene Ab- bruchquote ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Kinder hinsichtlich Verhü- tungsmittel früher und regelmäßiger geschult werden sollten, denn die hohe Ab- treibungsquote bei jungen Frauen unter 17 Jahren weist möglicherweise auf eine mangelnde Aufklärung hin.
4. Hilfesysteme zur Vereinbarung von Ausbildung und Kindeser-
Junge Eltern und insbesondere junge, allein erziehende Mütter ohne abgeschlosse- ne Berufsausbildung unterliegen einem hohen Risiko der Armutsgefährdung und geben diese Benachteiligung an ihre Kinder weiter. Um dieser Problemlage sozi- alpolitisch entgegenzuwirken ist die Teilzeitberufsausbildung eine große Chance, trotz eines Kindes, den Einstieg in die Berufswelt zu schaffen (vgl. Albert, Schmidt, Specht 2008, S. 6).
Im Jahre 1990 fand ein Forschungsprojekt statt, woraus die Frage entstand, warum junge Menschen zwischen 20 und 24 Jahren keinen Berufsabschluss haben. Bei der Auswertung zeigte sich, dass oftmals familiäre Hintergründe entscheidend dafür sind. Meist waren es junge Frauen, in Westdeutschland 11% und in Ost- deutschland 46%, die bereits eines oder mehrer Kinder hatten und dadurch keinen Abschluss machen konnten (vgl. Albert, Schmidt, Specht 2008, S. 18).
Zusätzlich unterliegen die Mütter einer strukturellen Benachteiligung hinsichtlich der unzureichenden Kinderbetreuung. Es gibt noch immer, insbesondere im westlichen Teil der Republik, eine Unterversorgung im Kleinkindbereich (vgl. Albert, Schmidt, Specht 2008, S. 44).
Im folgenden Teil der Hausarbeit werden neben der Teilzeitberufsausbildung weitere Projekte vorgestellt, die eine Integration der jungen Mütter in den Beruf vorsieht. Zudem werden finanzielle Förderungsmöglichkeiten aufgelistet und die aktuelle Situation von Kinderbetreuungseinrichtungen beschrieben, wodurch die soziale Situation der jungen Mütter verbessert werden kann.
[...]
1 Aktuellere Zahlen standen leider nicht zur Verfügung.