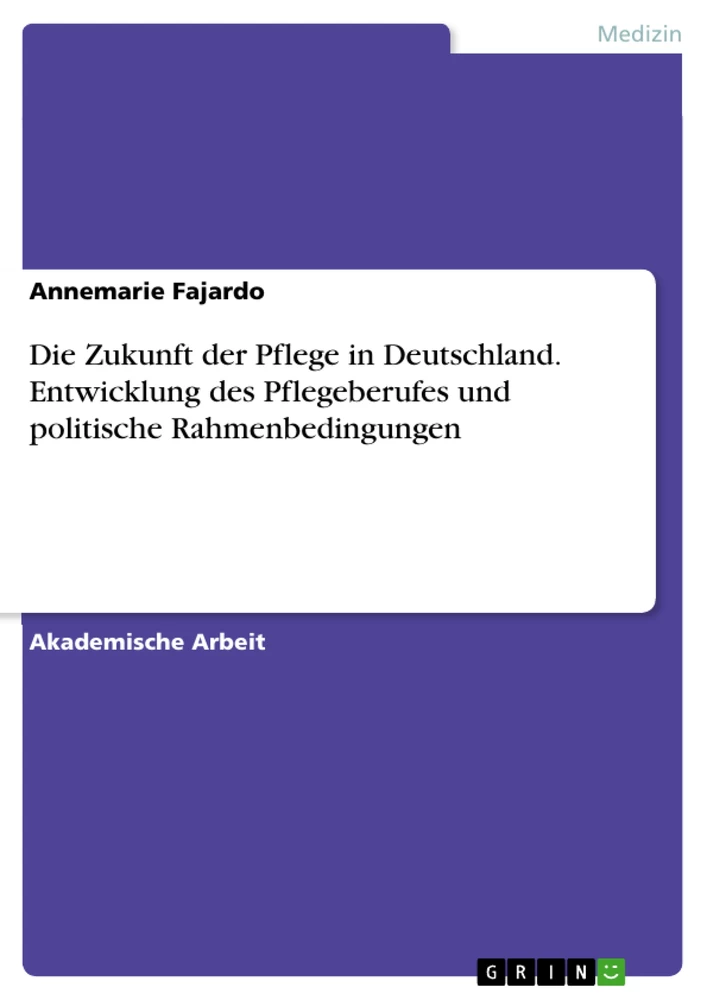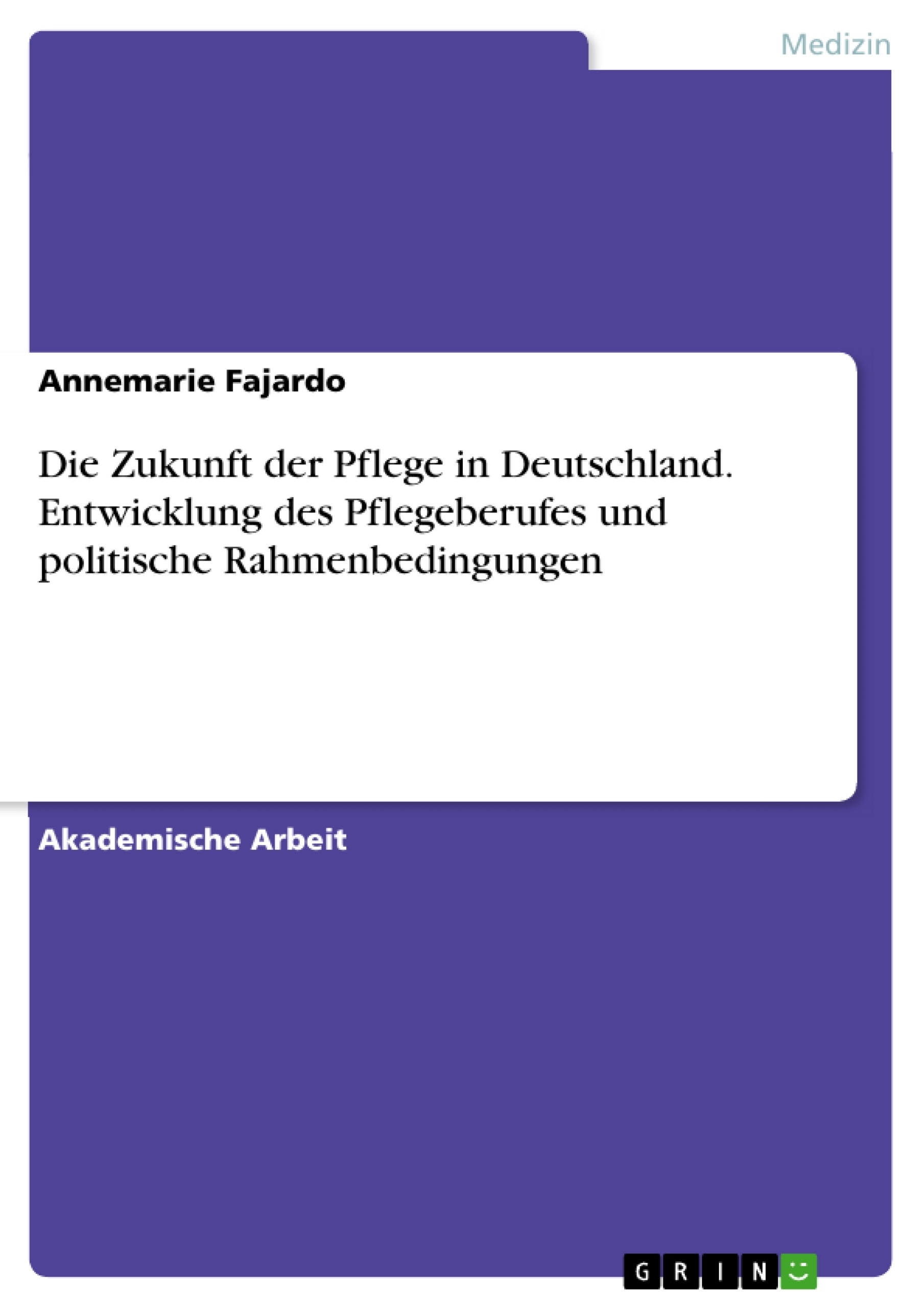Es gibt unzählige Beispielländer, in denen der Berufsstand der Pflege hoch angesehen ist, eine angemessene Bezahlung erhält und die gesellschaftliche Anerkennung eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Obwohl die Pflege in Deutschland ihren Ursprung hatte, konnte sie sich in vielen anderen Ländern wesentlich schneller entwickeln und auf gesellschaftlicher Ebene besser etablieren. Wie die Vergangenheit verdeutlicht, war es mitunter das christliche Leitbild, das die Pflege zu einem Beruf der Selbstlosigkeit werden ließ. Diese Ansichten haben sich bis heute nicht bedeutend verändert. So sind die Selbstlosigkeit, die besondere Tugendhaftigkeit und eine charismatische Persönlichkeit als Voraussetzungen für den Pflegeberuf zu sehen. Vor allem durch die Rolle der Berufsverbände und der Kirche, die von der einstigen Ansicht der Pflege als „Liebestätigkeit“ nicht abwichen, konnte sich diese Vorstellung von Pflege über viele Jahre hinweg halten. Hinzu kommt, dass der Berufsstand der Pflege aus der Ärzteschaft heraus entstand.
Durch die Professionalisierung und Akademisierung der Pflege wurde ein Wandel des Berufsbildes eingeleitet. So hat sich die Pflege in Deutschland bereits durch Fachweiterbildungen, entsprechende Spezialisierungen sowie die Etablierung von Studiengängen seit dieser Zeit deutlich weiterentwickelt. Mittlerweile gehören zum pflegerischen Berufsbild die „Handlungsfelder ... der präventiven, rehabilitativen und kurativen Patientenzentrierung auf der Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft und das Management des Berufes sowie Forschung und Lehre in der Pflege“ (Neumann 2009: 10). Diese Evolution der Pflege trägt entscheidend dazu bei, dass sich hinsichtlich der Wahrnehmung der Pflegetätigkeit diese vom „Dienen“ zur „modernen Dienstleistung“ verändern konnte.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Hinweis
1 Einleitung
2 Weitere Entwicklung des Pflegeberufes
2.1 Änderung des Rollenbildes der Pflegekraft
2.2 Änderung des Rollenbildes der Führungskraft in der Pflege
2.3 Der moderne Führungsstil
3 Politische Rahmenbedingungen
3.1 Zusammenschlüsse der Berufsverbände
3.2 Einführung einer Pflegekammer
3.3 Aufgaben einer Pflegekammer
4 Möglichkeiten der Arbeitgeber zur Attraktivitätssteigerung
5 Verantwortung der Arbeitgeber
Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)