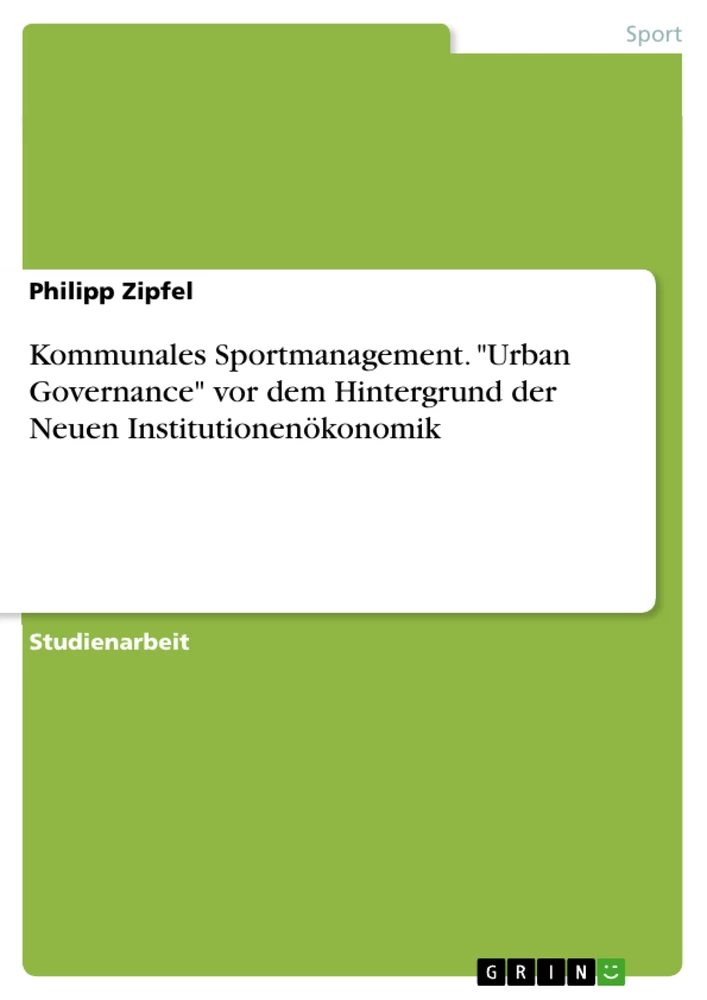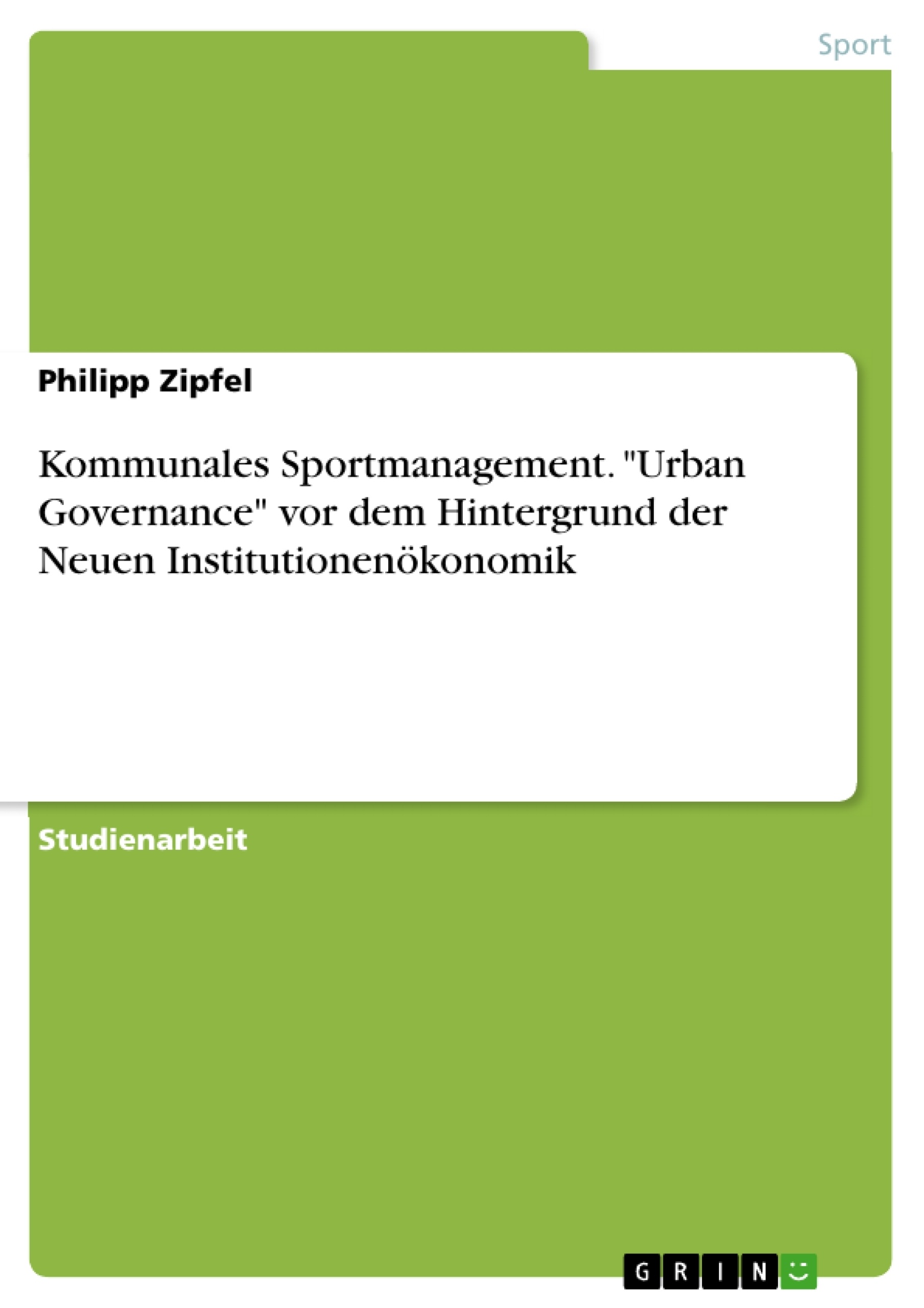Bund, Länder, Kommunen und private Wirtschaftsunternehmen fördern den Sport. Dem exemplarischen Charakter der Ausarbeitung folgend, soll die kommunale Sportförderung im Mittelpunkt stehen.
Die Beziehungen zwischen Vereinen, den beteiligten Kommunen sowie dazustoßen-den privaten Wirtschaftsunternehmen spielen nicht nur im Bereich des Profisports, sondern auch zunehmend im Bereich des kommunalen Sportmanagements eine Rolle. Ein interessantes Beispiel findet sich in einem Artikel der FAZ (2011) zum Münchner Sportamt, wo fünf hochqualifizierte kommunale Sportmanager an Infra-struktur, Management und der Organisation von Sportstätten und Großveranstaltungen arbeiten und dabei klären, wo „der sportliche, wirtschaftliche, touristische oder einfach nur öffentlichwirksame Mehrwert für die Stadt“ liegt.
Sport wird hauptsächlich durch die öffentliche Hand getragen, allerdings ergeben sich, bedingt durch die schlechte kommunale Haushaltslage, Engpässe und wach-sende Anforderungen an das Sportsystem. Innerhalb der Sportentwicklungsplanung müssen alternative Finanzierungs- und Steuerungsmöglichkeiten gefunden werden. Allerdings ist zu fragen, „ob und mit welcher Begründung [...] [die Kommune] in welchem Umfang Finanzmittel“ zur Verfügung stellen sollte. entdecken dabei eine zunehmende Bedeutung von alternativen „Finanzierungs- und Betreibermodel-le[n]“ und verlangen eine betriebswirtschaftliche Herangehensweise zur Lösung solcher Probleme .
In diesem Beitrag gehe ich von der Hypothese aus, dass die institutionenökonomi-sche Maßnahme Urban Governance (UG) zu einer entsprechenden Finanzierungs- und Allokationsfunktion im kommunalen Sportmanagement führen kann. Dabei soll gezeigt werden, wie entsprechend konkrete Handlungsmöglichkeiten abgeleitet wer-den können. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), die sich bereits für Wirtschaftsunternehmen bewährt hat. So soll die folgende Ausarbeitung die Frage beantworten, ob die institutionenökono-mische Maßnahme Urban Governance geeignet ist, die Ressourcenknappheit im kommunalen Sportmanagement zu beheben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung und Relevanz
2 Thematische Einordnung – kommunales Sportmanagement
3 Methodisches Vorgehen
4 Finanzierung und Ressourcenmanagement anhand des Fallbeispiels Körbe für Köln e.V.
4.1 Ökonomische Potentiale in der Sportentwicklung über die NIÖ
4.2 Urban Governance und die Neue Institutionenökonomik
4.3 Das Kölner Modell zur Steuerung lokaler sportbezogener Netzwerke – Körbe für Köln e.V.
5 Urban Governance aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik – Beispielhafte Lösungsmöglichkeiten anhand des Körbe für Köln e.V.
5.1 Transaktionskostenbezogene Maßnahmen zur Finanzierung und Steuerung von beteiligten Akteuren
5.2 Property-Rights zu Finanzierung und Ressourcenmanagement
5.3 Principal-Agent zu Finanzierung und Ressourcenmanagement
6 Diskussion
7 Fazit
Literaturverzeichnis