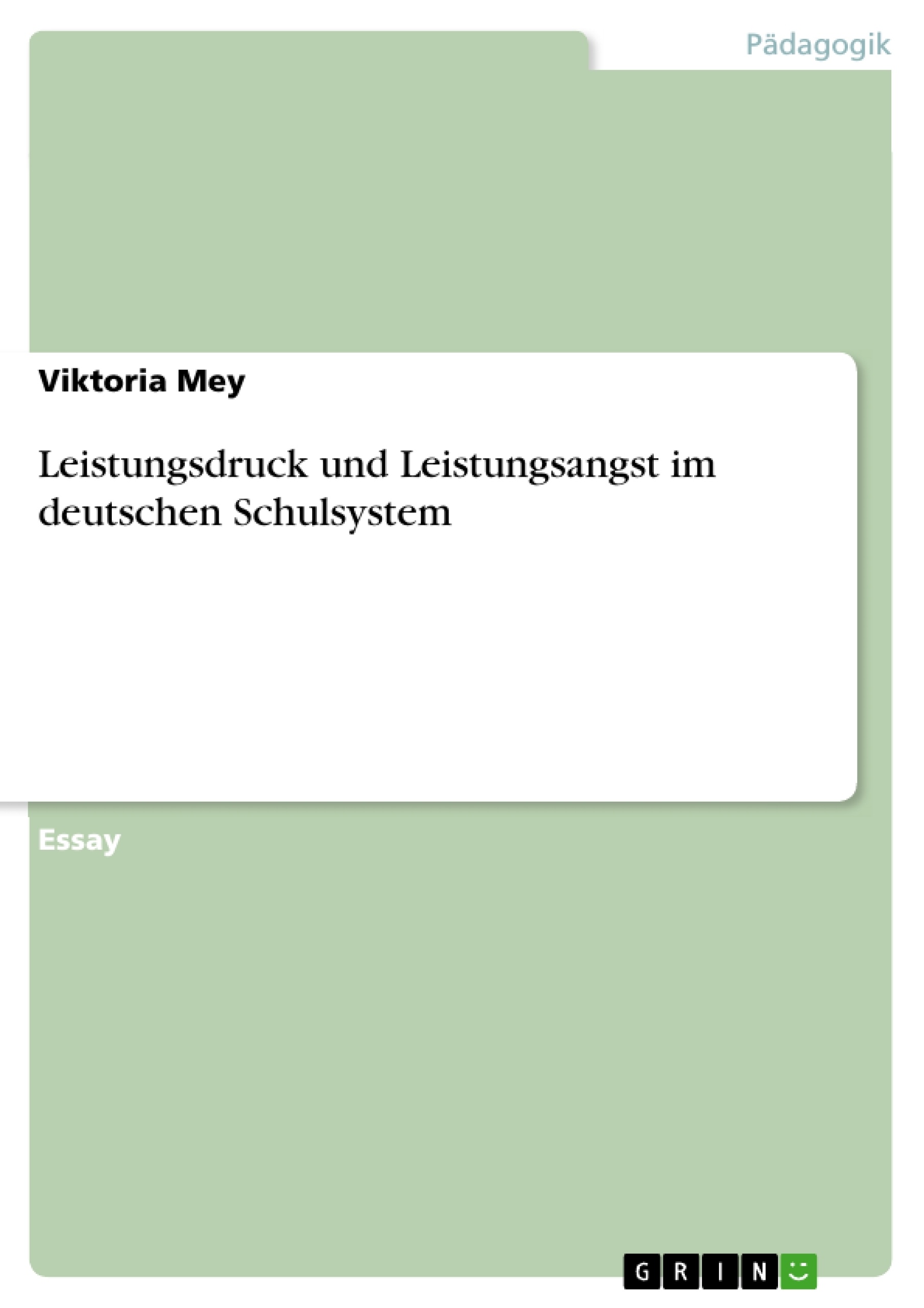In dieser Ausarbeitung möchte ich mich vertiefend mit der im Seminar behandelten Thematik „Leistungsdruck und Leistungsangst“ befassen.
Hierfür werde ich zum einen die Selektivität des deutschen Schulsystems sowie ihren Einfluss auf das Lernverhalten der Schüler/-innen erläutern, zum anderen aber auch die Problemlagen an Schulen, welche zu Lernstress und im Extremfall sogar zu Schulangst führen können. Auch die Ursachen für die Angst vor Wissensaneignung sowie die potentiellen Lernblockaden in Form von Erfolg und Misserfolg möchte ich im Folgenden thematisieren.
Aufgrund der Kürze dieser Ausarbeitung werde ich die meisten Aspekte jedoch eher als mögliche Gedankengänge eröffnen statt sie detailliert ausführen zu können.
Ich beschäftige mich mit dieser Thematik, da ich in meinen Praktika immer wieder den Eindruck hatte, dass der Leistungsdruck auf Schüler/-innen zunimmt und früher beginnt,
als es noch zu meiner Schulzeit der Fall war. Innerhalb des Seminars befassten wir uns dann kurz mit einer Befragung des DJI-Kinderpanel von Schneider aus dem Jahre 2005.
Laut dieser Befragung äußerten 44 Prozent der 8- bis 9-jährigen, dass sie bereits Angst davor hätten, im Unterricht Fehler zu machen. Da ich diesen Trend als aussagekräftig
und fast schon alarmierend empfunden habe, nahm ich mir vor, mich im Rahmen dieser Ausarbeitung näher mit den möglichen Gründen für diese Entwicklung zu befassen.
Leistungsdruck und Leistungsangst im deutschen Schulsystem
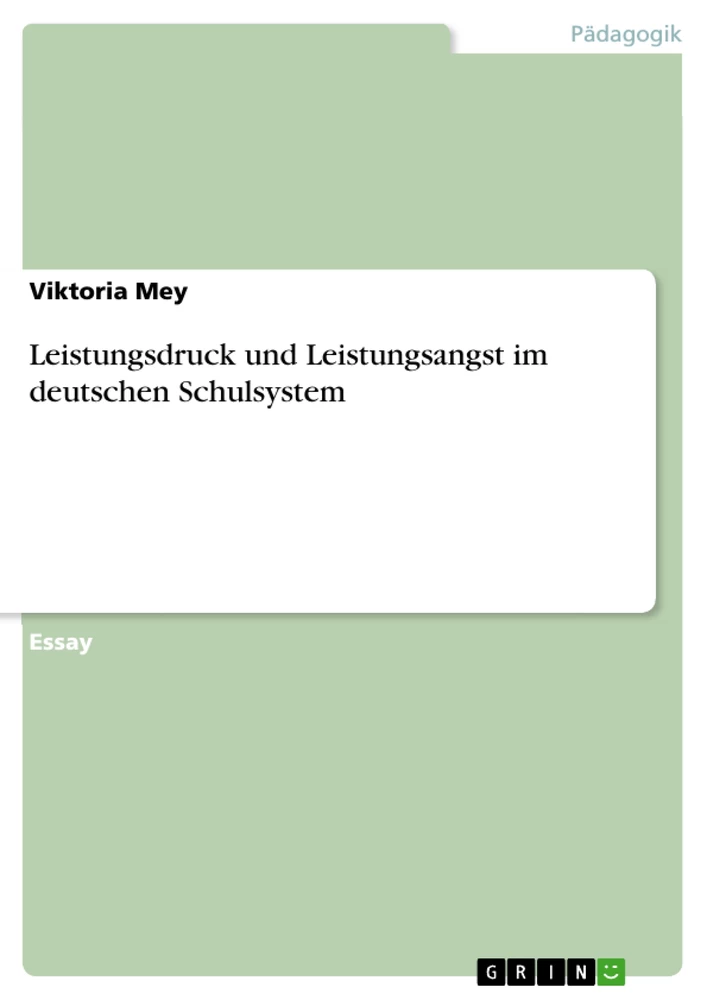
Essay , 2014 , 7 Seiten
Autor:in: Viktoria Mey (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch