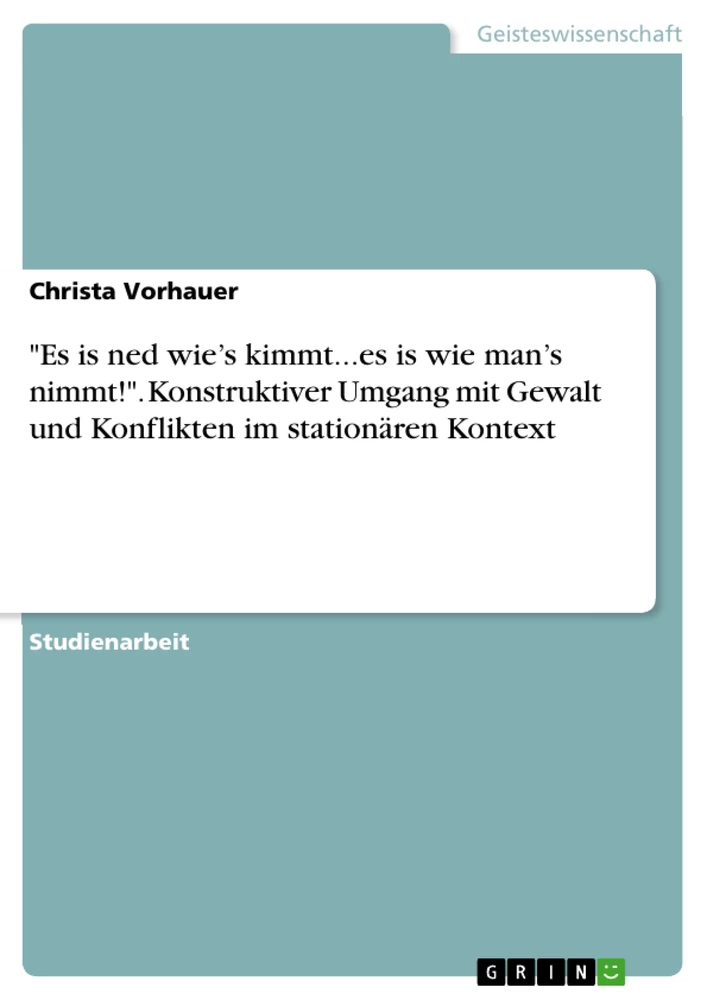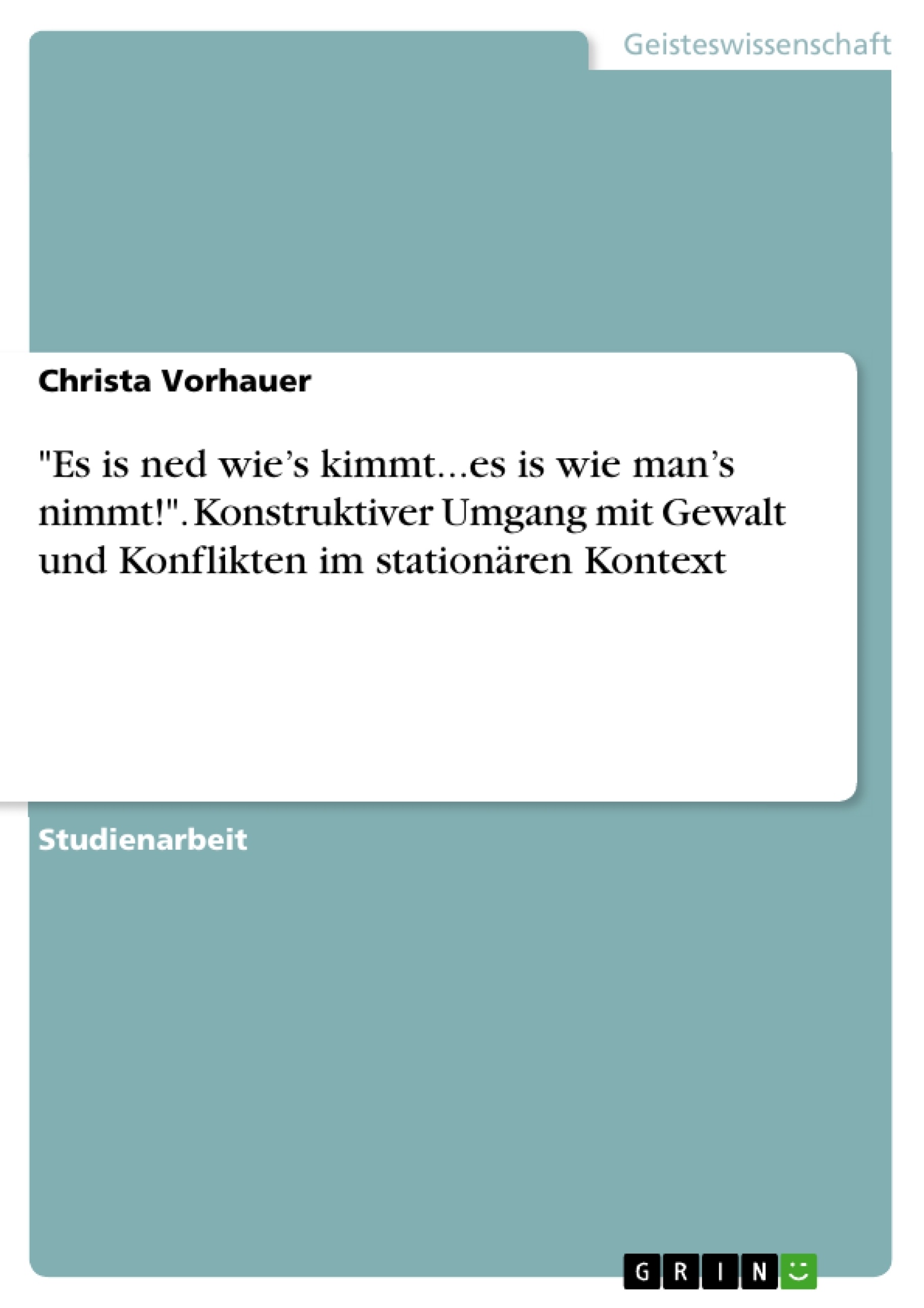Ausgangspunkt dieser Arbeit sind die latenten Formen von Gewalt und deren Folgewirkungen im gesellschaftlichen und insbesondere im Kontext der sozialpädagogischen Arbeit in stationären Einrichtungen.
Im ersten Teil befasse ich mich mit der Definition und den Erscheinungsformen von Aggression und Gewalt. Ich lege darin dar, dass man unterscheiden muss, zwischen naturgegebener und evolutionär entwickelter Gewalt. (gewaltig ≠ gewalttätig)
Behandelt werden die diversen Erscheinungsformen von Aggression und Gewalt, deren Entstehung und Zusammenhänge. Des Weiteren beleuchte ich sowohl die alltägliche Gewalt, wie auch jene, die anerzogen und antrainiert ist.
Speziell im Kontext der in der stationären Jugendbetreuung erfahrenen Gewaltpotentiale und deren Vorbeugung, Vermeidung sowie Bekämpfung. Konflikte und deren Lösung (Lösungsansätze) bilden den dritten Teil der Arbeit.
Nach der Frage von kommunikatorischen Entstehungen und dazugehörigen Lösungsansätzen richtet sich der letzte Teil der vorliegenden Arbeit. Den Abschluss bildet ein Resümee, welches meine eigenen Ideen und Gedanken beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition Gewalt
2.1. Erscheinungsformen von Aggression und Gewalt
3. Entstehung von Gewalt
3.1. Entstehungszusammenhänge
4. Gewalt in allen Lebensbereichen
4.1. Frustration
4.1. Nachahmung
4.1. Störendes Verhalten bewährt sich
5. Gewaltkreislauf nach J. Lempert
6. Bedürfnisse nach Maslow
7. Konflikte
7.1. Die neun Stufen der Konflikteskalation nach F. Glasl
7.2. Die drei Hauptphasen
7.3. Definition des „sozialen Konfliktes“ nach Glasl
7.4. Zusammenfassung Konflikte nach Friedrich Glasl
8. Konfliktarten im stationären Kontext
8.1. Konflikte der Jugendlichen mit der Einrichtung
8.2. Konflikte zwischen den Jugendlichen
8.1. Konflikte zwischen Jugendlichen und MitarbeiterInnen
8.2. Konflikte zwischen den MitarbeiterInnen
9. Konflikte - Bedrohung oder Chance?
10. Methoden der Konfliktbearbeitung
10.1. Gewaltfreie Kommunikation
10.2. Neue Autorität und gewaltloser Widerstand
10.3. Deeskalierende Kommunikation
10.4. Beispiele zur effektiven deeskalierenden Kommunikation
10.5. Leichtigkeit, Lockerheit und Lachen
11. Resümee
Literaturverzeichnis