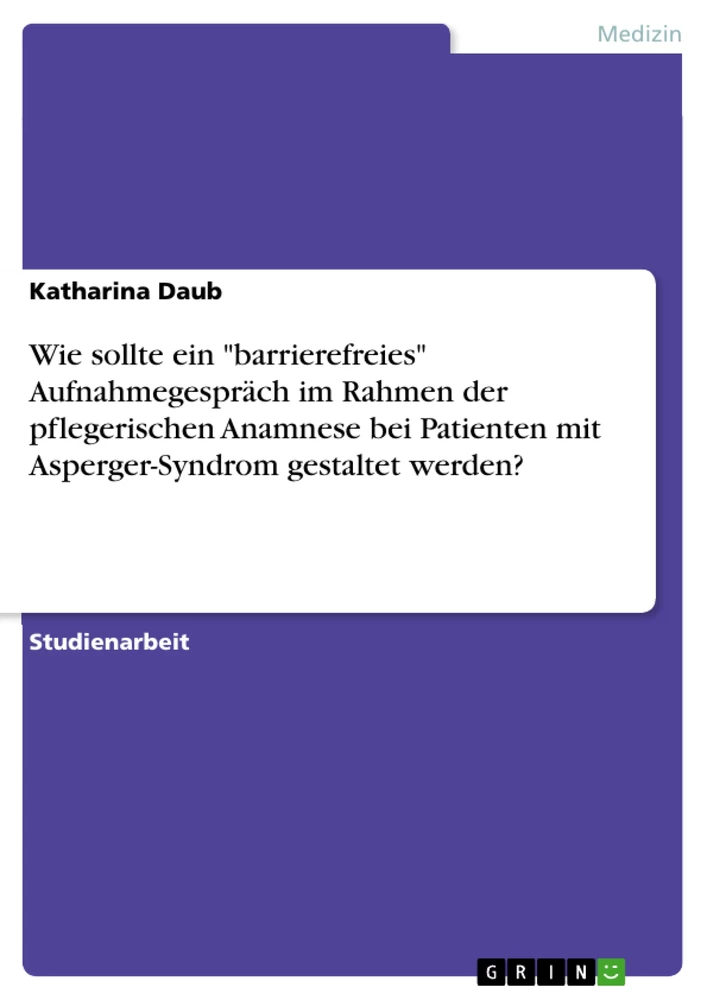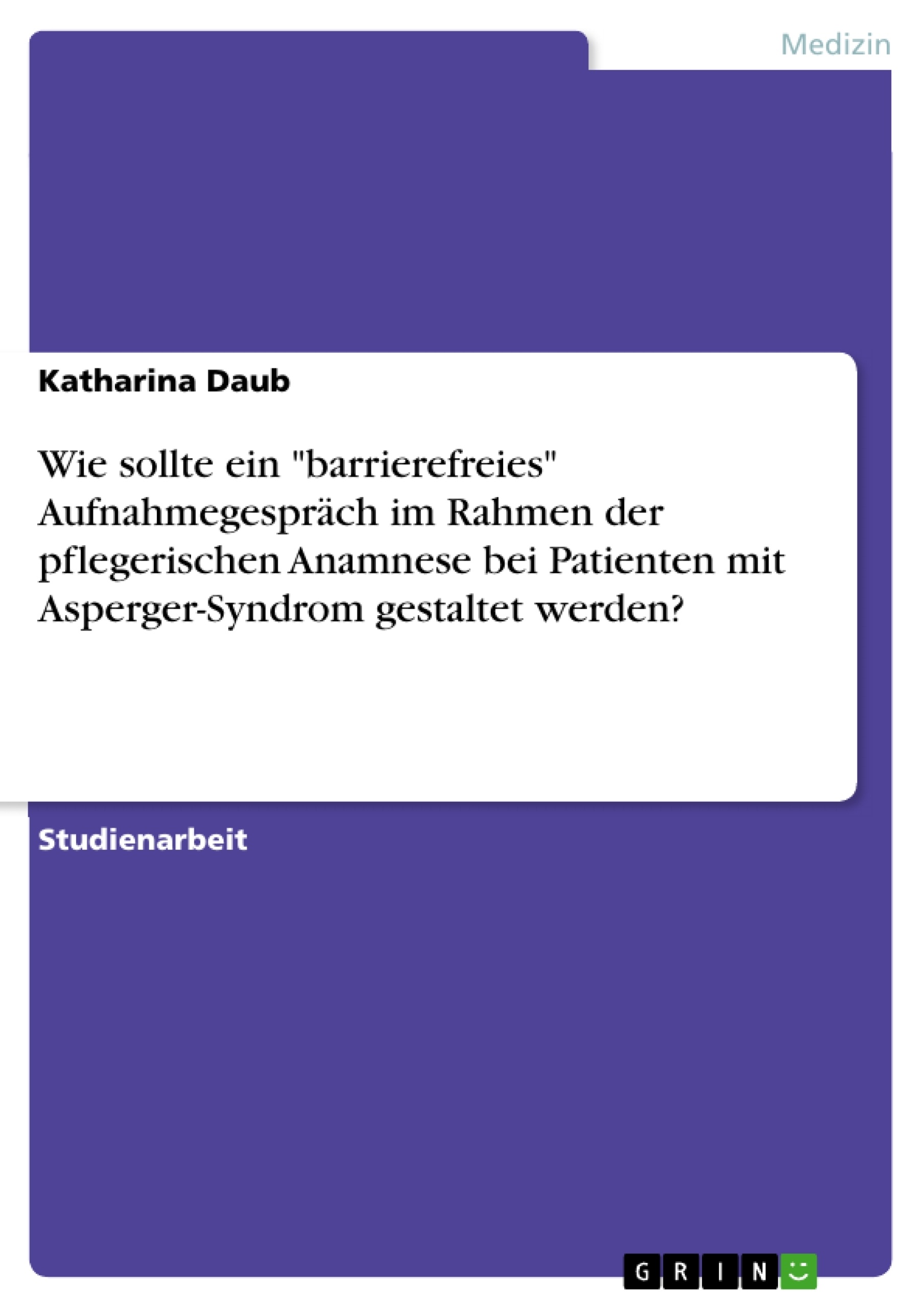„Menschen mit Behinderungen erfahren in vielen Lebenssituationen Beeinträchtigungen, die sie von der Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen Prozessen ausschließen. Ein Bereich, der bisher unzureichend in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten ist, stellt das Krankenhaus dar.“ (Bienstein 2006)
In dieser Hausarbeit soll die Fragestellung: „Wie sollte ein "barrierefreies" Aufnahmegespräch im Rahmen der pflegerischen Anamnese bei Patienten mit Asperger-Syndrom gestaltet werden?“ behandelt werden. Dazu wird zuerst die Autismus-Spektrum-Störung beschrieben, was dazu führen soll, näher auf das Asperger-Syndrom einzugehen. Im Anschluss daran wird die Krankenhausaufnahme beleuchtet. Dabei soll der Begriff „Barrierefreiheit“ genauer definiert werden.
Zusätzlich möchte die Autorin dem/der Leser/-in kurz darstellen, was eine pflegerische Anamnese bei der Krankenhausaufnahme überhaupt bedeutet. Daraufhin wird das Aufnahmegespräch durch Pflegekräfte bei Patienten mit dem Asperger-Syndrom beschrieben. Es sollen mögliche Probleme beschrieben werden, auf die Pflegekräfte während der Aufnahme stoßen können. Dies dient dem Zweck, Rahmenbedingungen aufzustellen, die es Pflegekräften und Patienten mit dem Asperger-Syndrom ermöglichen, eine pflegerische Anamnese „barrierefrei“ durchführen zu können. Zum Ende dieser Arbeit wird die Autorin noch einmal kurz die Ergebnisse reflektieren um zu einer Beantwortung der Fragestellung zu gelangen und ihre persönliche Meinung zu dem behandelten Thema zu schildern.
Zur Bearbeitung der Arbeit wurde in Moodle bereitgestellte Literatur von der betreuenden Professorin verwendet. Zusätzlich wurde im Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main und im Internet Literatur recherchiert. Es wurden Quellen aus den Jahren 2004 bis 2013 ausgewählt, die der Autorin als sinnvoll erschienen. Die verwendete Literatur ist deutsch- oder englischsprachig und lässt sich in Monographien, Sammelbändern, Zeitschriftenartikel und dem Internet wiederfinden. Es wird in der maskulinen Form von Patienten geschrieben, dies dient ausschließlich der Einfachheit. Die verwendeten Quellen finden sich im Literaturverzeichnis. Um Abkürzungen zu klären, dient der Anhang.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung in das Thema und Methode
2 Autismus
2.1 Die Autismus - Spektrum - Störungen
2.2 Das Asperger - Syndrom
3 Die Krankenhausaufnahme
3.1 Die Bedeutung von Barrierefreiheit
3.2 Die pflegerische Anamnese bei Patienten mit dem Asperger - Syndrom
4 Zusammenfassung und Fazit
5 Literaturverzeichnis