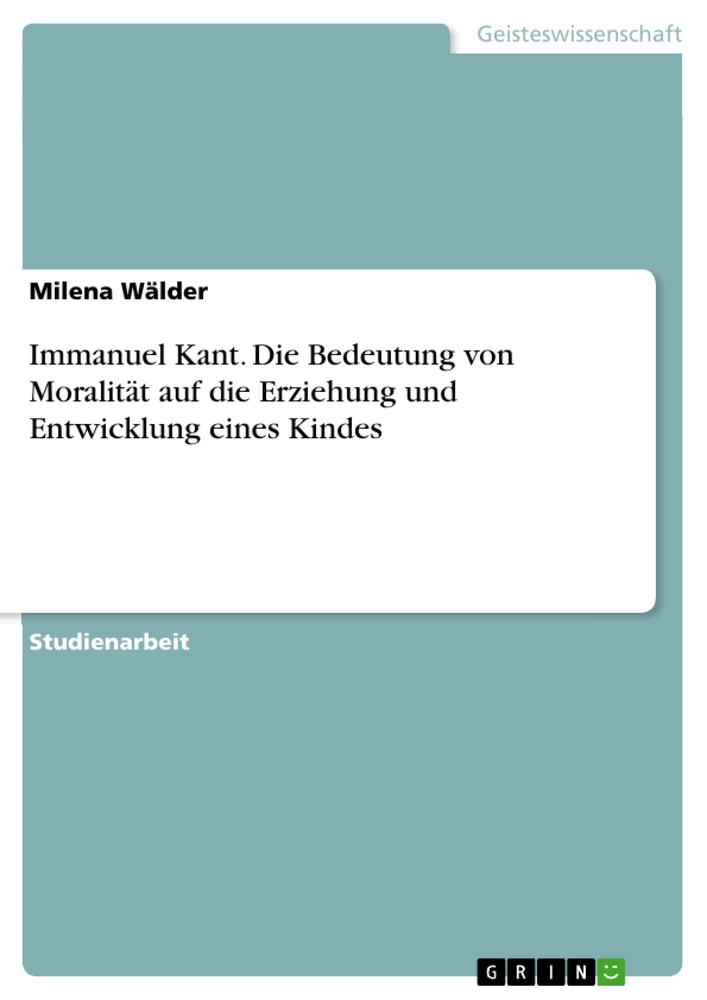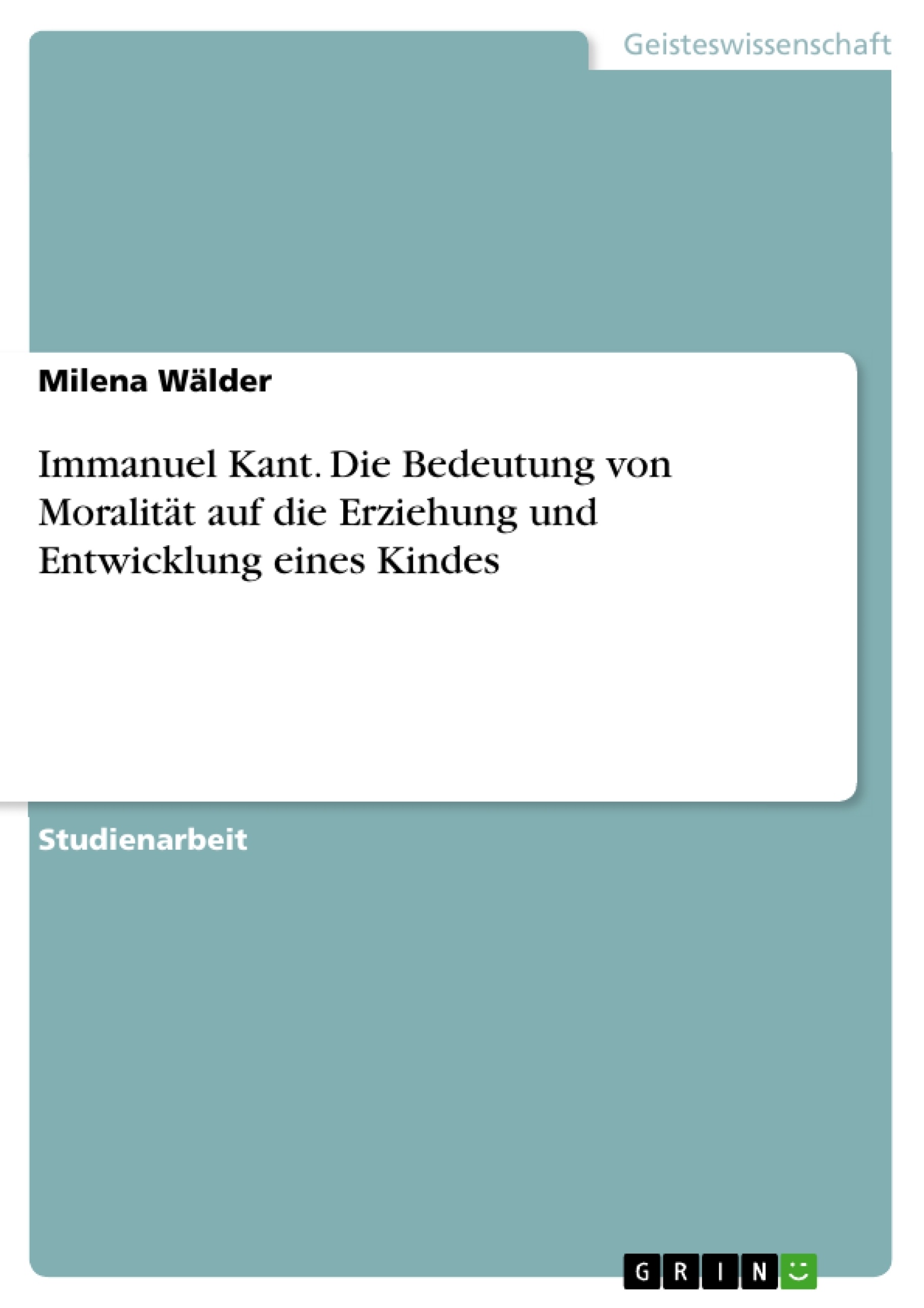Nach Kant ist der Mensch das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss. Laut ihm kann der Mensch erst durch Erziehung zum Menschen werden, er ist das, was die Erziehung aus ihm macht. Der Mensch hat in sich zwar die Anlage zum Guten, aber auch den Hang zum Bösen.
Daher ist gute Erziehung von hoher Wichtigkeit, da aus ihr alles Gute in der Welt entspringt. Die Erziehung zur Moral stellt für Kant die höchste Stufe der Erziehung dar. Sie muss durch verschiedene Mittel angeleitet werden. Eins davon ist das Vorbild. Eltern müssen Versprechen halten, ehrlich sein, moralisch authentische Haltung an den Tag legen, was dann dazu führt, dass das Kind auch solche Maximen ausbildet. Dabei wird die ethische Grundhaltung der Eltern oft nicht aktiv vermittelt, sondern unbewusst vorgelebt. Wenn Eltern im Alltag nicht ehrlich sind, geben sie der Ehrlichkeit in den Augen ihrer Kinder eine geringe Priorität; wenn ein Kind aber erkennt, dass seine Eltern auch Nachteile in Kauf nehmen für die Ehrlichkeit, dann wird es die Ehrlichkeit als moralischen Wert an sich erkennen. Nur dieses eine Beispiel zeigt schon, wie wichtig die Erziehung ist, da sie genau das ist, was der Nachwelt hinterlassen wird, das was die Gesellschaft bildet und ausmacht.
In dieser Hausarbeit geht es darum, den Zusammenhang von Moralität, wie sie Immanuel Kant in seiner Philosophie beschreibt, und Erziehung zu finden. Welche Rolle spielt sie in der Entwicklung des Kindes und welche Bedeutung hatte sie zu Zeiten Kants? Wichtigste Literatur für diese Untersuchung ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant. Zunächst wird die Erziehung nach Kant im Allgemeinen vorgestellt. Es folgt das Kapitel Kants Moralphilosophie.
Ausführlich wird dann zum kategorischen Imperativ, unterstützt von Kants Zitaten aus der GMS, hingeleitet. Damit ist eine Basis geschaffen, um sich mit dem Erziehungsbegriff nach Kant näher auseinanderzusetzen. In diesem Kapitel wird näher auf die Unterschiede der physischen und praktischen Erziehung eingegangen. Um den Aufbau der Erziehung nachzuvollziehen, werden die vier Etappen Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung vorgestellt.
Den Schluss bildet das Fazit, welches die genannten und zuvor diskutierten Untersuchungen von einer anderen Seite beleuchtet, kritische Aspekte aufzeigt und debattiert.
Inhalt
Einleitung
Die Erziehung nach Kant
Kants Moralphilosophie
Hinführung zum kategorischen Imperativ
Der gute Wille
Die Pflicht
Was ist eine Maxime?
Was ist ein Imperativ?
Kants Erziehungsbegriff
Die physische und die praktische Erziehung nach Kant
Die vier Etappen der Moralerziehung nach Kant
Disziplinierung
Kultivierung
Zivilisierung
Moralisierung
Fazit und Kritik
Beispiele, warum Kants Erziehungsansatz nicht mehr in die heutige Zeit passt
Literaturverzeichnis