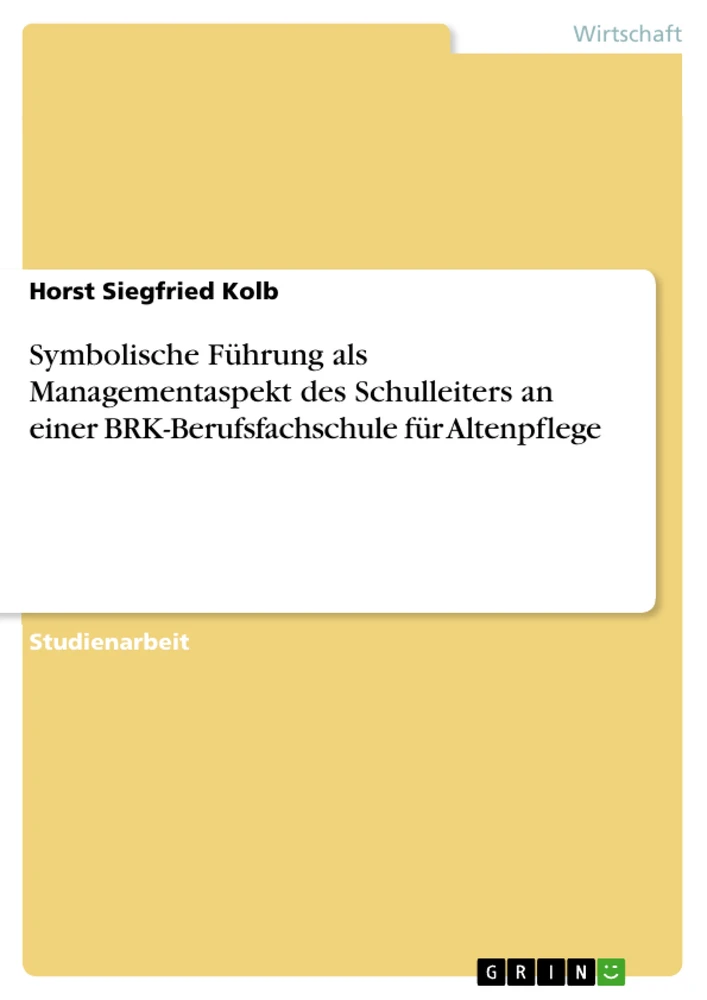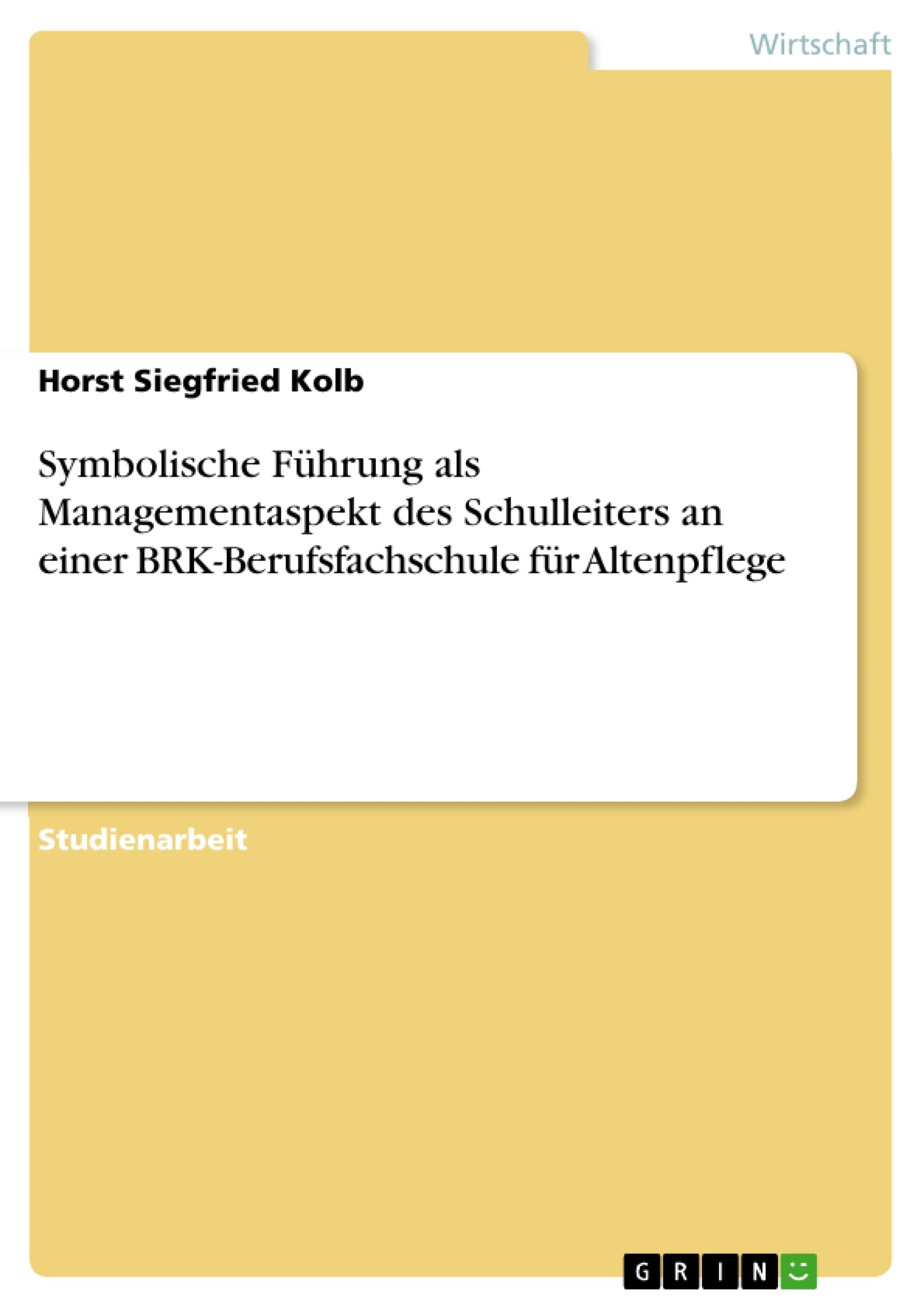Die Leitung einer Berufsfachschule für Altenpflege obliegt im Freistaat Bayern gemäß Berufsfachschulordnung Pflegeberufe dem Schulleiter, der die pädagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtverantwortung trägt.
In dieser Publikation geht es um die Darstellung der Symbolischen Führung allgemein, der Herausarbeitung, ob und inwieweit der Schulleiter in seiner Gesamtverantwortung Managementaspekte benötigt und einsetzt sowie deren Umsetzungsmöglichkeit. Um der Fragestellung: „Wie kann Symbolische Führung im Management einer BRK-Berufsfachschule für Altenpflege durch den Schulleiter genutzt und einbezogen werden?“ nachzugehen, erfolgt zunächst eine Klärung, welche Besonderheiten Symbolische Führung aufweist und was sie von anderen Führungsansätzen unterscheidet.
Bei den genannten Beispielen geht es um Nennungen mit deskriptivem Charakter und nicht normativen (An)-Forderungen. Die eigene berufliche Tätigkeit bedingt die Themeneingrenzung auf BRK-Berufsfachschulen, da eine glaubhafte Triangulation der Erkenntnisse aus Fachliteratur und Empirie immer nur vor dem Hintergrund einer eigenen Expertise erfolgen kann. Eine Übertragbarkeit auf Altenpflegeschulen anderer Bildungsträger scheint mit Modifikationen unter Berücksichtigung derer Eigenartigkeiten möglich.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung und Themeneingrenzung
2 Schulleiter als Schulentwickler
2.1 Begriffsklärung Schulentwicklung
2.2 Begriffsklärung Management
2.3 Zusammenführung der Begriffserklärungen
3 Symbolische Führung
3.1 Begriffsbestimmung
3.2 Theoretische Fundierung
3.3 Bedeutung für die Symbolische Führung
4 Symbole
5 Konkretisierung der Symbole
5.1 Objektivation
5.2 Handlungsroutinisierung
5.3 Verbalisation und Narration
6 Symbolisches Führen und Schulkultur
7 Kennzeichen symbolischen Führens
8 Konkrete Maßnahmen an BRK-Berufsfachschulen für Altenpflege
8.1 Maßnahmen der Objektivation
8.1.1 Kleidung mit Rot-Kreuz-Logo
8.1.2 Dresscode
8.1.3 Exklusive Ausstattung
8.1.4 Informationstafeln
8.1.5 Zertifikate
8.1.6 Schulleiter-Parkplatz
8.2 Maßnahmen der Handlungsroutinisierung
8.2.1 Ehrenamtliches Engagement
8.2.2 On-boarding neuer Mitarbeiter
8.2.3 Rot-Kreuz-Veranstaltungen
8.2.4 Festgesetzter Rhythmus für Teamsitzungen
8.3 Maßnahmen der Verbalisation und Narration
8.4 Deutungshoheit
9 Führungskraft als Marke
10 Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Anhang 1: BRK-Berufsfachschulen des BRK-Bildungsverbundes
Anhang 2: Aufgaben und Qualifizierungsbereiche für Schulleitungen 32 nach Schratz (2013:71)
Anhang 3: Artikel 1 (Bildungs- und Erziehungsauftrag) des 33 Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
Anhang 4: Führungsgrundsätze
Anhang 5: Leitlinien
Anhang 6: Grundsätze des Roten Kreuzes
Literaturverzeichnis
Weitere Publikationen
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Aufgaben eines Schulleiters 10 (Eigene Darstellung in Modifikation und Anlehnung an Schratz 2013:71 sowie Berücksichtigung von Rolff 2013:21)
Abb. 2: Symbolische Führung 16 (Eigene Darstellung in Modifikation und Anlehnung an Neuberger 1989 zit. in v. Rosenstiel & Nerdinger 2011:335)
Abb. 3: Verfestigung und Verflüssigung 20 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Neuberger 2002:668)
Abb. 4: Zusammenspiel der Faktoren X und Y 21 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Blessin & Wick 2014:456)
Abb. 5: Aufgaben und Qualifizierungsbereiche für Schulleitungen 32 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Schratz 2013:71)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung und Themeneingrenzung
Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einerseits und mit einer historisch gewachsenen Sonderstellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) im Freistaat Bayern, nimmt im Auftrag des Bundeslandes, die durch die jeweiligen Bezirksregierungen erteilte Verantwortung wahr, innerhalb insgesamt acht Berufsfachschulen, Auszubildende zum Beruf des / der Staatlich anerkannten Altenpflegers / Altenpflegerin zu führen. Diese Berufsfachschulen sind zusammen mit solchen, die (auch) andere Bildungsgänge anbieten (Anhang 1) im BRK- Bildungsverbund organisiert. Gemäß dessen Selbstverständnisses sind alle „Berufsfachschulen (BFS) des BRK Bildungsverbundes [...] zertifiziert, fachlich hoch kompetent, methodisch up to date und stets der Menschlichkeit verpflichtet." (Bildung BRK 2015:1) Der Ausbildungsgang führt in drei Jahren zu einem staatlichen Abschluss (§ 4 AltPflG 2013) und kann unter Voraussetzungen um ein Jahr auf dann zwei Ausbildungsjahre verkürzt werden. (§ 7 AltPflG 2013) Die Leitung einer BRK-Berufsfachschule obliegt gemäß Berufsfachschulordnung Pflegeberufe dem Schulleiter, der „die pädagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtverantwortung" (§ 49 BFSO Pflege 2014) trägt. Im Folgenden geht es daher um die Darstellung der Symbolischen Führung allgemein, der Herausarbeitung, ob und inwieweit der Schulleiter in seiner Gesamtverantwortung Managementaspekte benötigt und einsetzt sowie deren Möglichkeiten zur Umsetzung. Bei den genannten Beispielen geht es um Nennungen mit deskriptivem Charakter und nicht normativen (An)-Forderungen. Obwohl das Bayerische Rote Kreuz über einen Kanon von Grundsätzen und insbesondere auch Führungsgrundsätzen verfügt, wurde der Symbolischen Führung weder im Allgemeinen, noch in Bezug auf die spezielle Schulleiterposition bisher Aufmerksamkeit gewidmet. Aufgrund der eigenen Tätigkeit als Gesundheits- und Pflegepädagoge mit Berufserfahrung an zwei BRK- Berufsfachschulen für Altenpflege soll hier ein Beitrag entstehen um diese Lücke zu schließen. Die eigene berufliche Tätigkeit bedingt auch die Themeneingrenzung, da eine glaubhafte Triangulation der Erkenntnisse aus theoretischer Fachliteratur und Empirie immer nur vor dem Hintergrund einer eigenen Expertise erfolgen kann. Eine Übertragbarkeit der Symbolischen
Führung durch den Schulleiter einer BRK-BFS für Altenpflege auf andere Berufsfachschulen des Bayerischen Roten Kreuzes ist sicherlich gegeben und könnte hier Anlass zu weiteren Publikationen geben. Der Transfer auf Altenpflegeschulen anderer Bildungsträger wie denen der Caritas, der Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt scheint mit Modifikationen möglich, auf weitere Mitbewerber aus dem profitorientierten Bereich privater Schulträgern müsste vor dem Hintergrund deren Eigenartigkeiten erfolgen.
2 Schulleiter als Schulentwickler
Grundsätzlich gilt, dass Schulentwicklung (SE) als eine Aufgabe der gesamten Schule definiert, getragen und angesehen werden muss. Hierdurch entwickelt diese eine eigene Schulidentität, die gezielt kommuniziert werden kann. „Schulleitung, Lehrerkollegium, Eltern und Schüler müssen dabei gleichermaßen mitwirken, um das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein für die ganze Schule zu aktivieren." (KM BY 2001:20) Trotzdem kommt dem Schulleiter eine Sonderrolle zu, denn er trägt die „pädagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtverantwortung" (§ 49 BFSO Pflege 2014). Studiengänge, wie der der TU Kaiserslautern (Master of Arts; Schulmanagement) tragen diesem Umstand Rechnung und gehen in mehreren Studienbriefen explizit darauf ein. So konstatiert Schratz (2013:71) als Aufgaben und Qualifizierungsbereiche für Schulleitungen, dass diesen für die Steuerung der Schule grundsätzlich drei Aufgabenbereiche zukommen. Er erkennt unter dem Oberbegriff der „Pädagogischen Führung" die Bereiche „Management-Aufgaben", „Leadership-Aufgaben" und „Pädagogische Aufgaben", die sich seines Erachtens zu den drei Anforderungen „Schulentwicklung", „Personalentwicklung" und „Unterrichtsentwicklung" zusammenfügen. (Schratz 2013:71-74) (Anhang 2)
2.1 Begriffsklärung Schulentwicklung
Schratz (2013:73) verortet den Begriff „Schulentwicklung" gleichauf mit „Personalentwicklung" (PE) und „Unterrichtsentwicklung" (UE). Für ihn ist Schulentwicklung ein gemeinsames Bemühen innerhalb und außerhalb der Schule „ihre unterschiedlichen Wertvorstellungen und Fähigkeiten so zu nutzen, dass die Schule als Organisationseinheit die auf sie zukommenden Aufgaben konstruktiv gestalten kann." (Schratz 2013:VIII) Damit verlässt er die Logik seiner eigenen Darstellung und beschreibt, was Rolff (2012:6; 2013:15) unter „Organisationsentwicklung“ versteht. Dies, obwohl er selbst noch den Begriff „Organisationseinheit“ verwendet!
Für die folgenden Ausführungen wird daher unter Anlehnung an das Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung (Rolff 2013:20) der Begriff der Schulentwicklung als Oberbegriff verwendet. Es wird weiter Rolff (2013:21) gefolgt, dass es „keine UE ohne OE und PE, keine OE ohne PE, keine PE ohne OE und UE“ gibt. Der vereinfachenden Summenformel SE = OE + PE + UE, die gelegentlich anzutreffen ist, von Rolff (2013) aber nicht explizit angegeben wurde, kann nicht gefolgt werden. Vielmehr muss Schulentwicklung als eine Funktion aus OE, PE und UE verstanden werden, in der sich diese systemisch verhalten. Es gilt daher: SE = f (OE; PE; UE).
2.2 Begriffsklärung Management
Beim Blick in die einschlägige Literatur fällt auf, dass Begriffe wie „Management“, „Führen“, „Leiten“ und auch „Leadership“ zum Teil vage und manchmal auch austauschbar verwendet werden. Schratz (2013:17) verweist darauf, dass der englische Begriff „Leadership“ im deutschsprachigen Bereich deshalb Verwendung findet, um „dem durch den Nationalsozialismus belasteten Führungsbegriff zu entgehen [...]“. Er verweist darauf, dass Management Leadership benötigt - und umgekehrt! (Schratz 2013:19) und schafft weitere Unsicherheit indem er, unter Bezugnahme auf Hinterhuber (2003:20) dem Management eher Aufgaben zuweist, die dem Leiten entsprechen. Was bleibt ist die Frage: Was ist Management und wie sind Leiten und Führen zu verorten?
Entwicklung - und damit auch Schulentwicklung ist immer ein Bestandteil von Management. (Buchen 2009:44;46) „Management kann [...] als eine Querschnitts-aufgabe und als die Gesamtheit aller gestaltenden, steuernden, richtungsgebenden und entwickelnden Funktionen einer Gesellschaft oder als Transformation von Wissen in Leistung und Nutzen verstanden werden.“ (Malik 2000:87) Auch Buchen (2009:43) schließt, dass „Management [...] stets
und in allen Organisationen eine Querschnittsaufgabe [ist]. „Management steuert als Querschnittsfunktion den Einsatz der Ressourcen und das Zusammenwirken der Sachfunktionen (Unterrichten, Personal, Finanzen usw.)." (Buchen 2009:45) Wird Malik (2013) gefolgt, so kann Management als Oberbegriff angesehen werden, der Leitungsaufgaben wie beispielsweise die Förderung von Menschen oder das Organisieren ebenso beinhaltet wie Führungsaufgaben, welche eher im Bereich der Zielsetzung bzw. Zielvereinbarung, dem Kontrollieren, Messen oder Beurteilen anzusiedeln sind. (Malik 2013:378)
2.3 Zusammenführung der Begriffserklärungen
Werden die Erklärungen der einzelnen Begriffe zusammengefügt so soll für die nachfolgenden Ausführungen zum Bereich der Symbolischen Führung als Managementaspekt des Schulleiters gelten, dass unter Management der Oberbegriff für Leiten und Führen zu verstehen ist. „Unter Führen versteht man im Wesentlichen: Richtung geben, Struktur schaffen, Krisen steuern, neue Wege entwickeln." (Schweißgut 2015:1) Während „Führen" also eher auf einer individuellen, autokratischen Entscheidung beruht, wird unter „Leiten" verstanden, eine „gegebene Struktur [zu] organisieren und [zu] optimieren" (Schweißgut 2015:1) und beinhaltet einen eher kollektiven, demokratischen Charakter. Beides wird für Management benötigt und beeinflusst damit die Entwicklung - auch die Schulentwicklung.
Werden diese Erkenntnisse in das Aufgaben- und Qualifikationsprofil nach Schratz (2013:71) eingearbeitet und der Ansicht von Rolff (2013:21) bezüglich der Verwendung der Begrifflichkeiten SE, OE, PE und UE gefolgt, so ergibt sich ein Modell, wie es die folgende Abbildung verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Aufgaben eines Schulleiters
(Eigene Darstellung in Modifikation und Anlehnung an Schratz 2013:71 sowie Berücksichtigung von Rolff 2013:21)
Es wird dabei deutlich, dass Führung, nachfolgend wird auf Symbolische Führung eingegangen, alle drei Bereiche der Schulentwicklung beeinflusst. Die Aufgaben eines Schulleiters liegen neben dem Bereich des Managements, welcher durch Leitungsaufgaben und Führungsaufgaben abgebildet werden, auch im Bereich von fachlichen Aufgaben. Fachlichkeit heißt dabei im Kontext Schule immer pädagogische Fachlichkeit, die zu pädagogischen Aufgaben führt. Je nach Anteil dieser Aufgaben werden Entwicklungen in den Bereichen Organisation, Personal und Unterricht angesteuert. Dabei muss es Ziel sein, in jedem Aspekt die Qualität zu sichern und zu entwickeln (Qualitätsmanagement) um damit effektive Schulentwicklung gestalten zu können.
3 Symbolische Führung
Um der Fragestellung: „Wie kann Symbolische Führung im Management einer BRK-Berufsfachschule für Altenpflege durch den Schulleiter genutzt und einbezogen werden?" nachzugehen, muss zunächst eine Klärung erfolgen, welche Besonderheiten Symbolische Führung aufweist und was sie von anderen Führungsansätzen unterscheidet. Nerdinger (2014:92) verweist darauf, dass es im Führungsprozess nicht nur darauf ankommt, „was ein Vorgesetzter macht, sondern auch wie er es macht" und verweist auf das Konzept der transformationalen Führung. Dieses versieht das Verhalten des Vorgesetzten - hier des Schulleiters - mit einer Bedeutung, die nicht nur direkte sondern auch indirekte Wirkungen entfaltet. Von den Wirkungen können dabei alle am Schulentwicklungsprozess beteiligten (Lehrer, Schüler, Eltern, Kooperationspartner) betroffen sein. Für Nerdinger (2014:92) symbolisiert Führungsverhalten die Werte und Überzeugungen eines Unternehmens - also einer Schule und beschreibt Symbolische Führung als gezielten Einsatz dieser Tatsache. (Nerdinger 2014:92 unter Bezug auf Neuberger 2002)
3.1 Begriffsbestimmung
Symbolische Führung „weist darauf hin, dass Mitarbeiterführung auch durch Symbole und Symbolisierung wirken kann. Es kommt nicht allein darauf an, was im Führungsprozess geschieht, sondern auch darauf, wer dies wie tut." (Becker 1994:534) Der aus dem Griechischen stammende Begriff „Symbol" meint dabei im ursprünglichen Sinne „Zusammenfügung" bzw. „Zusammen- gefügtes" und verweist dabei darauf, dass es sich um einen zerbrochenen Gegenstand (Ring, Medaillon) handelte, der im früheren Griechenland als Erkennungs- und Legitimationszeichen diente, sofern die Teile beim Zusammensetzten passten. (Blessin & Wick 2014:455) Eine kurze und doch prägnant eingängige Definition der Symbolischen Führung gab Weibler (1995:2022) indem er schreibt:
„Unter Symbolischer Führung wird eine zielgerichtete soziale Einflussnahme verstanden, die Symbole einsetzt und/oder selbst symbolisch gedeutet wird.“
Dabei wird „Symbolische Führung" als ein Führungskonzept verstanden, in dem eine tatsächliche Führung stattfindet und nicht - wie alleine aus der Begrifflich- keit auch abgeleitet werden könnte - eine Führung nur „symbolisch" also „als ob" besteht.
3.2 Theoretische Fundierung
Der Vorgang der Symbolischen Führung stützt sich sozialwissenschaftlich auf das Social Construction Paradigma in dem soziale Wirklichkeit durch menschliche Handlungen und deren Interpretationen konstruiert werden. Fleischer & Jarek (o. J.:3) Es handelt sich dabei nicht um einen linearen Vorgang sondern vielmehr beeinflussen die Beobachter ihre Beobachtungen, so dass zirkulär, ja systemisch gedacht werden muss. „Im sozialen Umfeld kommt dem Deuten oder Interpretieren eine zentrale Rolle zu. Das gilt umso mehr für die sozial exponierte Führungsrolle: Was Führende tun, ist nie eindeutig - es muss interpretiert werden [...]." (Blessin & Wick 2014:455)
Es ist dabei das Verdienst von Herbert Blumer, der sich intensiv in die Überlegung George H. Meads vertiefte und auch durch seine eigenen Veröffentlichungen das Social Construction Paradigma innerhalb der Theorie der Symbolischen Interaktion („Symbolischer Interaktionismus") in die Wissenschaft, speziell die Soziologie, einbrachte. (Helle 2001:93)
Blumer hat dabei „zwei Punkte immer wieder betont:
1. Es kommt darauf an, den Sinn, die Bedeutung (meaning) der Objekte zu erschließen.
2. Zu diesem Vorgang des Verstehens muss davon ausgegangen werden, dass den Objekten ihre Bedeutung im Handeln zugewiesen wird."
(Helle 2001:93)
Herbert Blumer geht dabei in Übereinstimmung mit George H. Mead davon aus, dass diese Wahrnehmung der Objekten, also der Symbole, innerhalb eines Wechselspiels (Interaktion) zwischen dem bzw. den Handelnden und der Umwelt gewonnen werden. Diese steuert anschließend den Handlungsverlauf. (Helle 2001:99) „Den Gedanken einer Wechselwirkung zwischen Begriffsbildung und Wahrnehmung führt Blumer weiter aus. Der Mensch begegnet gewissen wahrnehmbaren Erfahrungen, die ihm mittelbar zugänglich sind, die aber rätselhaft wirken und sich dem Verständnis zunächst entziehen." (Helle 2001:100) Er ist daher notwendigerweise zur Interpretation seiner Wahrnehmung der Begriffe, wie Blumer (2013) Objekte und Symbole auch nennt, aufgefordert. Zur Interpretation der Symbole nutzt der Mensch sein „Spiegelselbst". Der Gedanke des „Spiegelselbst" geht davon aus, dass soziale Interaktionen in vielen Fällen davon geprägt sind, wie der Interpretierende gegenüber seinem eigenen Selbst denkt und so einem anderen Menschen gegenüber, diesem ebenso ein Bewusstsein zuschreibt. (Cooley 1972:232)
Der Geführte nimmt also, basierend auf dem Symbolischer Interaktionismus innerhalb der Symbolischen Führung Objekte, Begriffe, Handlungen wahr, welche für ihn Symbole darstellen, und interpretiert diese vor dem Hintergrund seines Spiegelselbst. Helle (2001:135) weist weiterhin darauf hin, dass das Verstehen einer Interaktion jedoch nicht so einfach ist: Vielmehr ist das zusätzlich Komplizierende, dass viele Aktionen (= Symbole des Führenden) und „viele Reaktionen [= Symbole des Mitarbeiters] nicht voll bewusst geschehen." Strauss (1959:58) erkennt in jeder denkbaren Situation folgende Möglichkeiten:
- Der Mitarbeiter kann auf Symbole bewusst reagieren.
- Er kann eine unbeabsichtigte Geste als Symbol werten und bewusst darauf reagieren.
- Mitarbeiter können auf bewusste symbolische Handlungen ihres Vorgesetzten in einer Weise reagieren, die ihnen selbst nicht bewusst sind.
- Der Mitarbeiter kann unbewusst auf ein Symbol reagieren, welches auch dem Sender, also dem Vorgesetzten nicht (voll) bewusst war.
Anzufügen bleibt, was Strauss (1959:58) dabei nicht explizierte, heute innerhalb des Interaktionsprozesses aber bekannt ist: Es kann auch zum bewussten oder unbewussten Ausbleiben einer Reaktion kommen, so dass die oben dargestellte Auflistung jeweils um den Begriff „nicht" vervollständigt, zu insgesamt acht möglichen Interaktionsformen führen kann.
Innerhalb des Interaktionsprozesses fordert Strauss (1959:59), dass jeder beteiligte Interaktionspartner bei seinem Gegenüber dreierlei Dinge stets beurteile:
- Allgemeine Absicht, die der andere innerhalb der aktuellen Situation verfolgt.
- Einstellung des Partners sich selbst gegenüber.
- Einstellungen und Emotionen gegenüber dem Beobachter.
Dies ist notwendig, da das „menschliche Zusammenleben aus und in dem gegenseitigen Aufeinander-Abstimmen der Handlungslinien durch die Beteiligten besteht" (Blumer2013:83) besteht. Handlungen stehen nicht alleine sondern sind miteinander verkettet. Blumer (2013:83) spricht von „Verkettung von Handlungen" und weißt darauf hin, dass solch „eine Verbindung von Handlungslinien [...] gemeinsames Handeln‘ entstehen und begründen" lässt. Damit hat sich der Symbolische Interaktionismus sich zur „Kennzeichnung eines relativ klar abgegrenzten Ansatzes zur Erforschung des menschlichen Zusammenlebens und des menschlichen Verhaltens durchgesetzt" (Blumer 2013:63) und beruht letztlich auf drei Prämissen:
„Die erste Prämisse besagt, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen.
Unter ,Dinge‘ wird hier alles gefasst, was der Mensch in seiner Welt wahrzunehmen vermag [...].
Die zweite Prämisse besagt, dass die Bedeutung solcher Dinge von der sozialen Interaktion, die man mit einem Mitmenschen eingeht, ausgeht oder aus ihr erwächst.
Die dritte Prämisse besagt, dass diese Bedeutungen in einem interpre- tativen Prozess, den die Person in der Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert werden.“
(Blumer 2013:63)
[...]