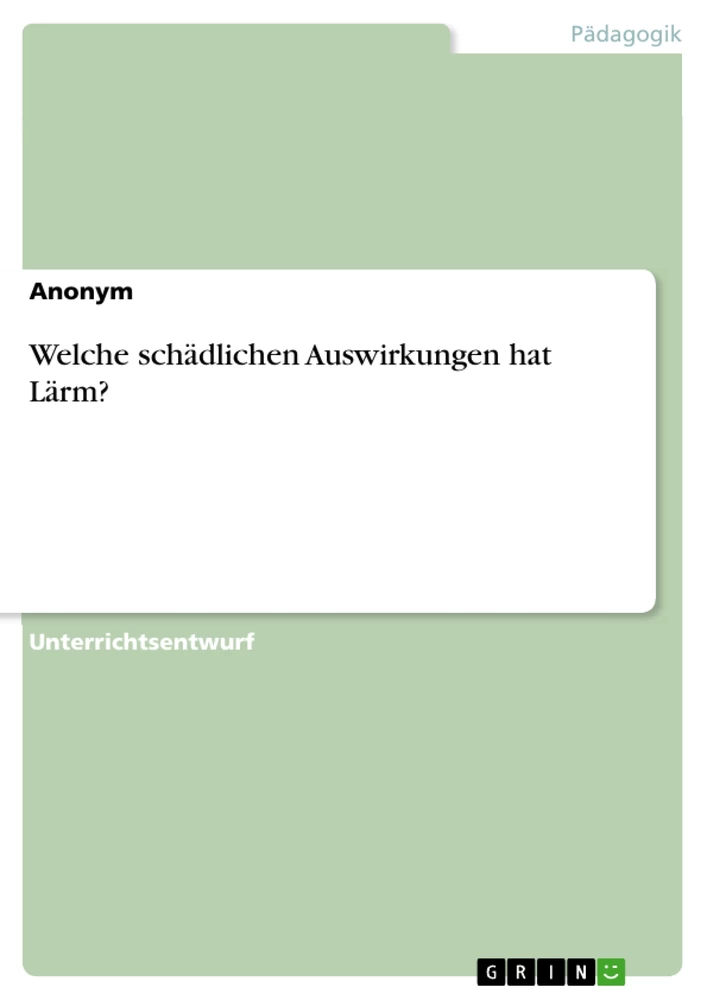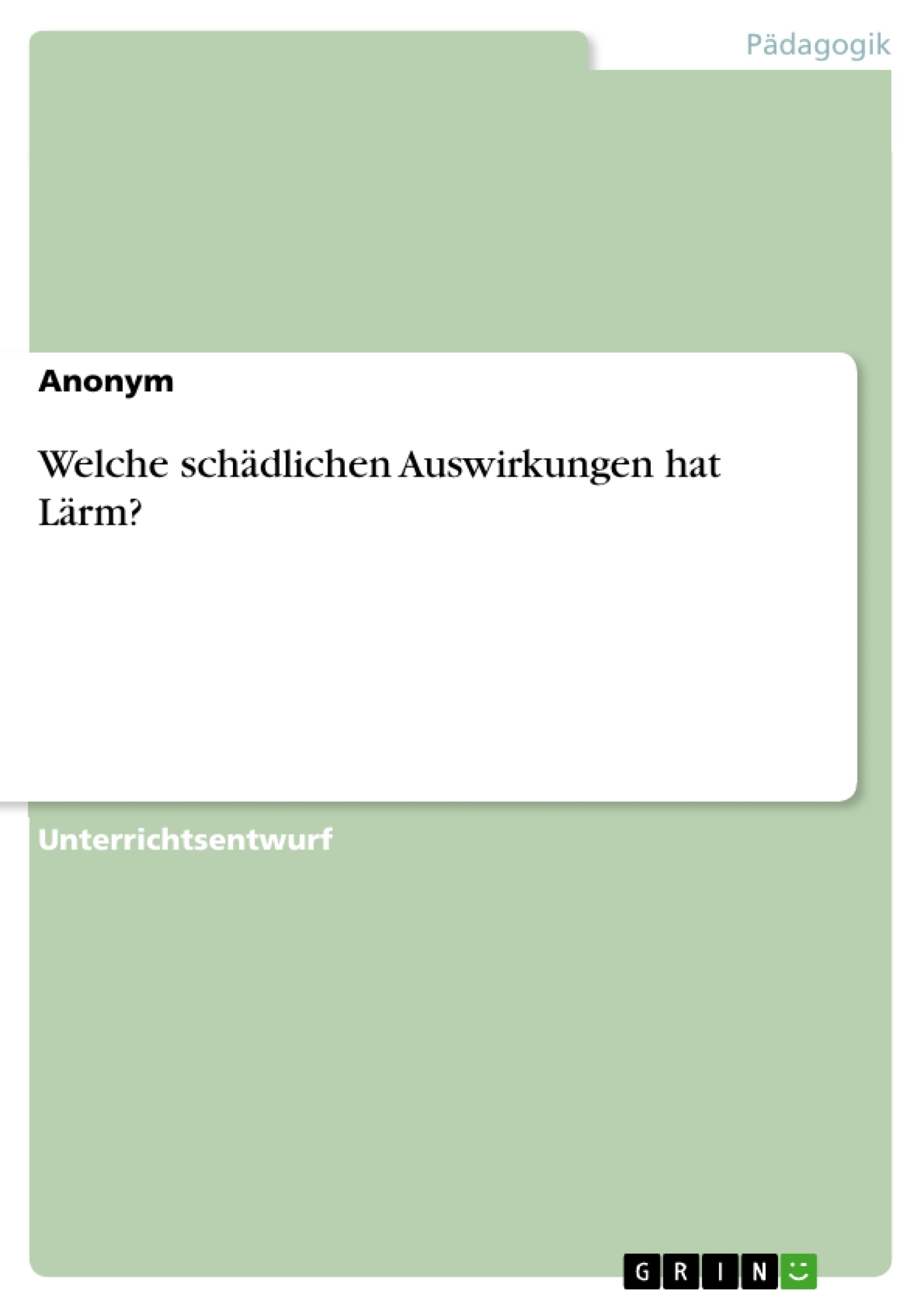Die vorliegende Arbeit stellt eine Analyse einer lebensweltbezogenen Unterrichsstunde zu den Gefährdungen des Gehörs dar. Nach einer didaktischen Analyse wird die Zielsetzung der Unterrichtseinheit vorgestellt.
Auszug:
Der Gehörsinn ist einer der sechs menschlichen Sinne und ermöglicht uns Menschen Kommunikation und Orientierung. Von daher ist eine gewisse Grundkenntnis unabdingbar, um sich selbst und seinen Körper besser verstehen zu können. Aus gesundheitlicher Sicht und im Hinblick auf das Krankenversicherungssystem hat der Schutz des Gehörs nicht nur individuelle Relevanz, sondern auch gesamtgesellschaftliche.
Zu Beginn der Unterrichtsstunde ist es unverzichtbar, relevantes Vorwissen zu aktivieren. Dazu ordnen die Schülerinnen und Schüler wichtige Begriffe, die sie als laminierte Kärtchen am Platz haben. Sie versuchen, diese in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, die Anordnung zu begründen und die Begrifflichkeiten fachlich bergründet zu klären. Schnellere Schüler können noch ein Lerndomino (ebenfalls in Kärtchenform + laminiert) legen, dass ihnen ebenfalls von der Vorstunde bekannt ist. Anschließend erfolgt im Plenum eine Musterlösung an der Tafel, bei der sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler einbringen. Dies dient
auch der Rhythmisierung des Unterrichts. Sämtliche Fachtermini, die Verwendung finden, sind prinzipiell für die Erarbeitung von Bedarf. Das Wissen wurde in den Vorstunden erarbeitet und stellt somit indirekt eine Sequenzrückschau dar.
Inhaltsverzeichnis
1. Analyse der Unterrichtseinheit
1.1. Didaktische Analyse
1.1.1. Legitimation
1.1.2. Methodische Analyse
2. Zielsetzung
2.1. Lehrplanbezug
2.2. Darstellung der Lehrsequenz
2.3. Lernziele
3. Artikulation des Unterrichts
4. Materialien