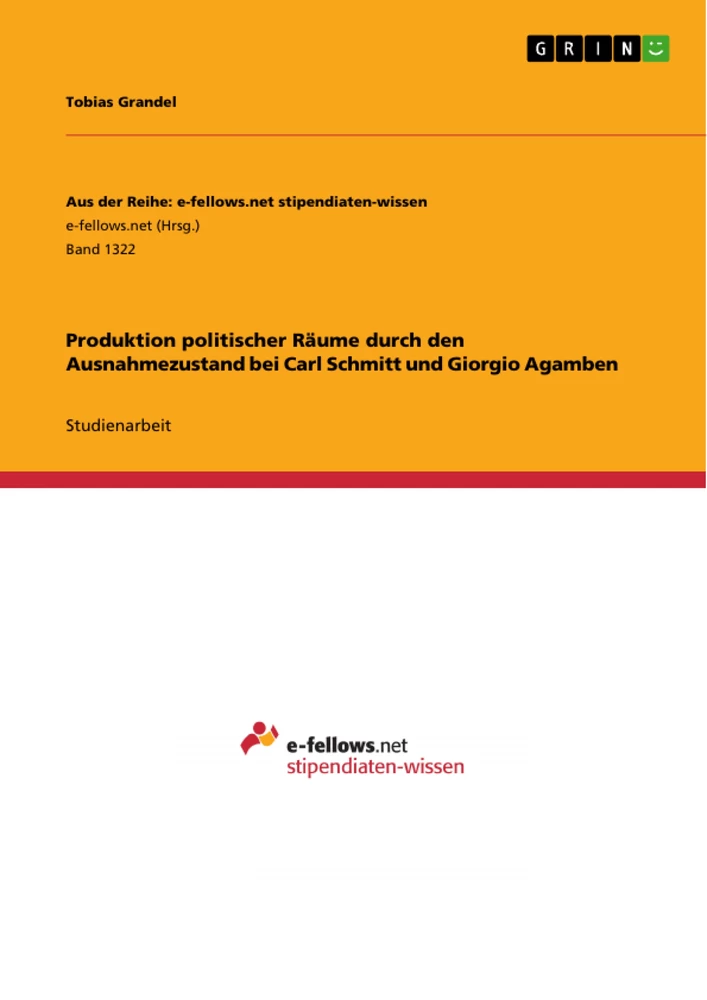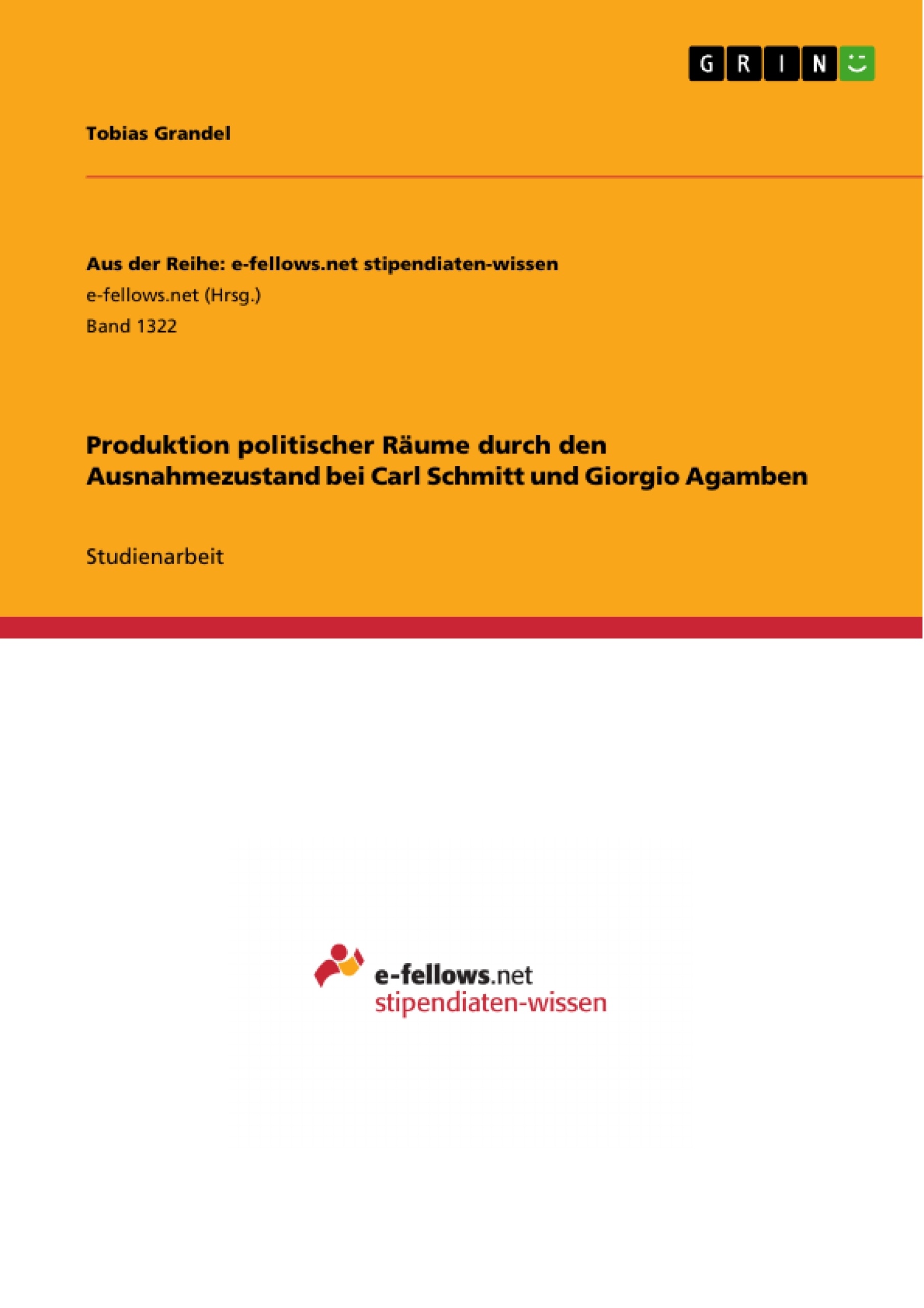„Wir sind so gewöhnt, Gesetz und Recht im Sinne der Zehn Gebote als Gebote und Verbote zu verstehen, deren einziger Sinn darin besteht, dass sie Gehorsam fordern, dass wir den ursprünglich räumlichen Charakter des Gesetzes leicht in Vergessenheit geraten lassen. Jedes Gesetz schafft vorerst einen Raum, in dem es gilt, und dieser Raum ist die Welt, in der wir uns in Freiheit bewegen können. Was außerhalb dieses Raumes ist, ist ohne Gesetz und genau gesprochen ohne Welt; im Sinne menschlichen Zusammenlebens ist es eine Wüste.“ (Arendt 1993: 121 nach StadtBauwelt 2006: 20).
Das Wissenschaftsmodul RaumZeit im Sommersemester 2014 behandelte philosophische Themen des Raumes. In diesem Rahmen wählte ich als Themengebiet des politischen Raumes. Es stellte sich heraus, dass Politik im Vergleich etwa zum sozialen Raum seltener unter einem räumlichen Aspekt untersucht wird. Bei der Suche nach einem geeigneten Thema stieß ich in der Vorlesung „Was ist Raumproduktion? Und was machen wir mit dem Spatial Turn?“ von 2010 auf den Satz „Politik auf Raumargumenten ist gefährlich“, was mich dazu brachte, mich anhand des im Seminar behandelten Werkes „Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch“ (Günzel 2010) mit dem Verhältnis von Politik und dem physischen Raum auseinanderzusetzen.
Der vorliegende Text gibt anhand der auf der Rechtsphilosophie Carl Schmitts aufbauenden Hauptwerk Giorgio Agambens zum Homo Sacer und dem Ausnahmezustand einen Einblick in die Produktion und Konstitution politischer Räume. Untersucht wird die Figur des Flüchtlings als Homo Sacer in der Bundesrepublik Deutschland und die daraus resultierende Beziehung zwischen Biopolitik und Totalitarität.
Inhalt
1..... Einführung. 3
1.1. Was ist politischer Raum? Einordnung in den Diskurs. 3
2..... Carl Schmitt (1888-1985). 5
2.1. Das Politische und die Freund-Feind-Unterscheidung. 5
2.2. Der Souverän und der Ausnahmezustand. 6
3..... Giorgio Agamben (*1942). 7
3.1. Der Homo Sacer. 7
3.2. Der Ausnahmezustand bei Agamben. 8
3.3. Biopolitik und der Flüchtling. 10
3.4. Verräumlichung des Ausnahmezustands im Lager. 10
3.4. Der Totalitarismus. 11
4..... Übertragung auf aktuelle Verhältnisse anhand der Situation von Refugees. 13
4.1. Die souveräne Ausnahme in der Flüchtlings- und Asylpolitik. 13
4.2. Die Flüchtlingsunterkunft als Lager. 15
5..... Fazit. 16
6..... Anhang. 17