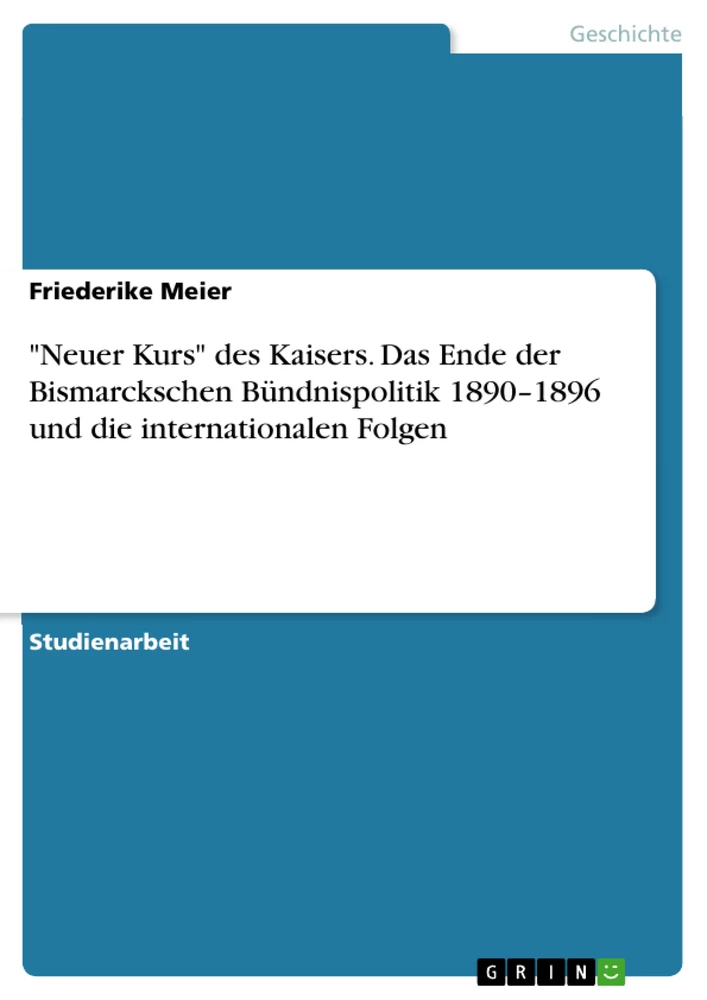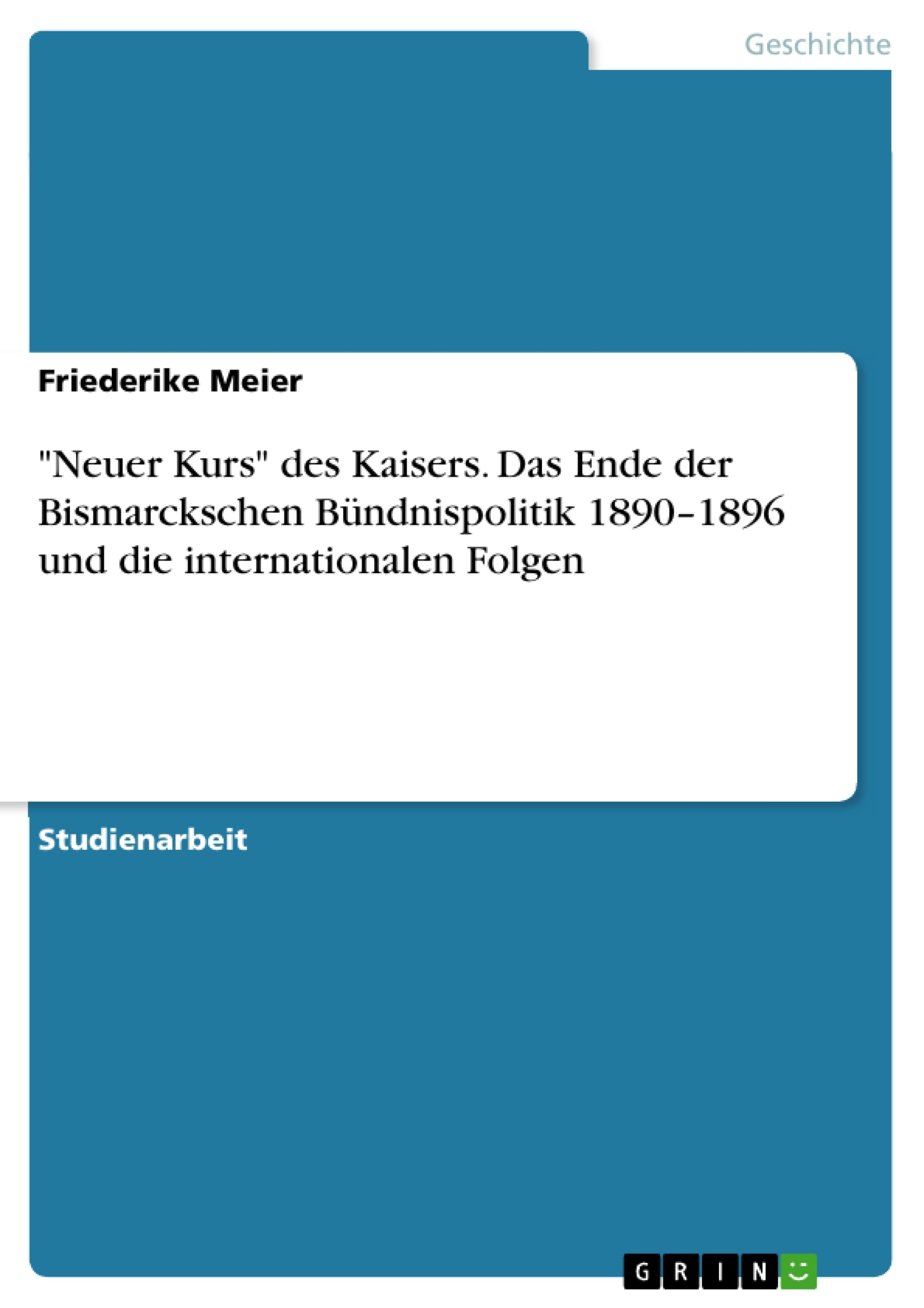Mit dem Sturz Bismarcks hatte außenpolitisch eine neue Zeit begonnen, neue Männer waren an der Macht. In kurzer Zeit manövrierten die Politiker des "Neuen Kurses" Deutschland aus dem bisherigen Bismarckschen Bündnissystem heraus. Dazu wollten sie zum einem Bismarcks Vertrag mit Russland lösen, England näher an sich binden und damit den Dreibund stärken. Doch entwickelten sich daraus ungewollte Konstellationen auf dem europäischen Kontinent, die so wohl nicht gewollt waren und Deutschland sogar letztlich in die Isolation führten.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Außenpolitik des "Neuen Kurses" von 1890 bis 1896 und geht dabei besonders auf die Frage ein, inwieweit der "Neue Kurs" die außenpolitische Situation des deutschen Reiches veränderte. Um die neue außenpolitische Situation in den Jahren 1890 bis 1896 zu verstehen, untersucht diese Arbeit vor allem drei Ereignisse, die aus den drei hauptsächlichen Ziele des "Neuen Kurses" resultierten: die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrages mit Russland, die koloniale Annäherung an England mit dem "Helgoland-Sansibar-Vertrag" und die vorzeitige Erneuerung des Dreibundes zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien.
Wie veränderten diese Ereignisse die außenpolitische Situation Deutschlands in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts? Was für Konsequenzen hatte die neue Politik für die anderen Großmächte und wirkte es sich auf die europäische Konstellation aus? Und weiterhin die Frage: gab es hier schon eine Weichenstellung zur Blockbildung des ersten Weltkriegs?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Forschungsstand
Der Neue Kurs
Beteiligte Personen
Leo von Caprivi
Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein
Friederich von Holstein
Die Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages
Vorgeschichte
Caprivis Absage
Russisch-französische Annäherung
Annäherung an England
Helgoland-Sansibar-Vertrag
Schwierigkeiten
Erneuerung des Dreibundes
Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis