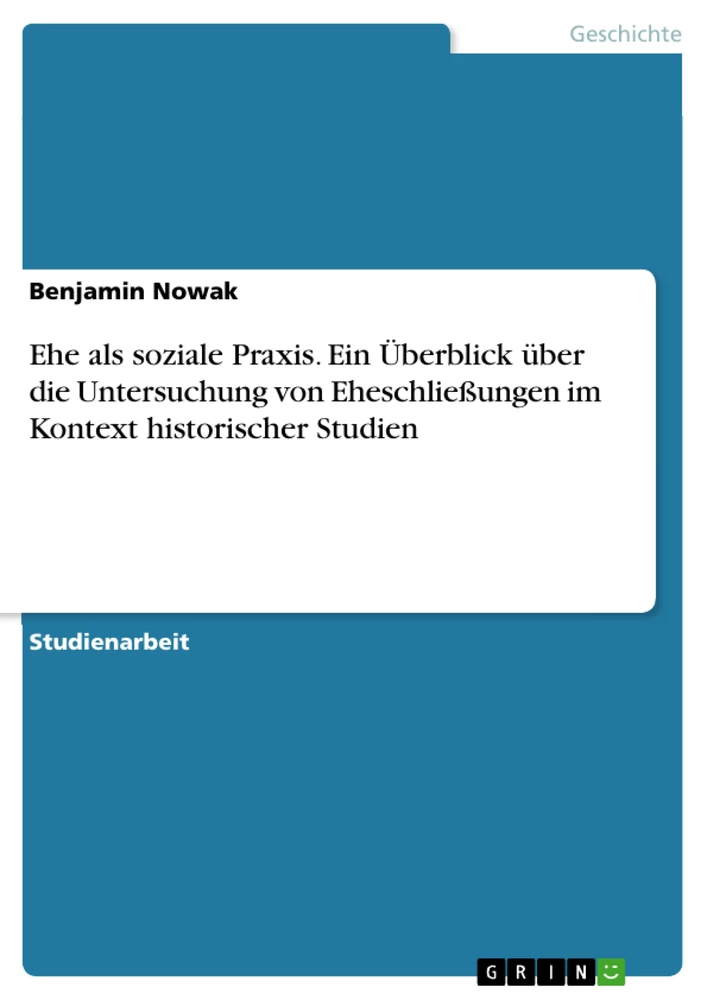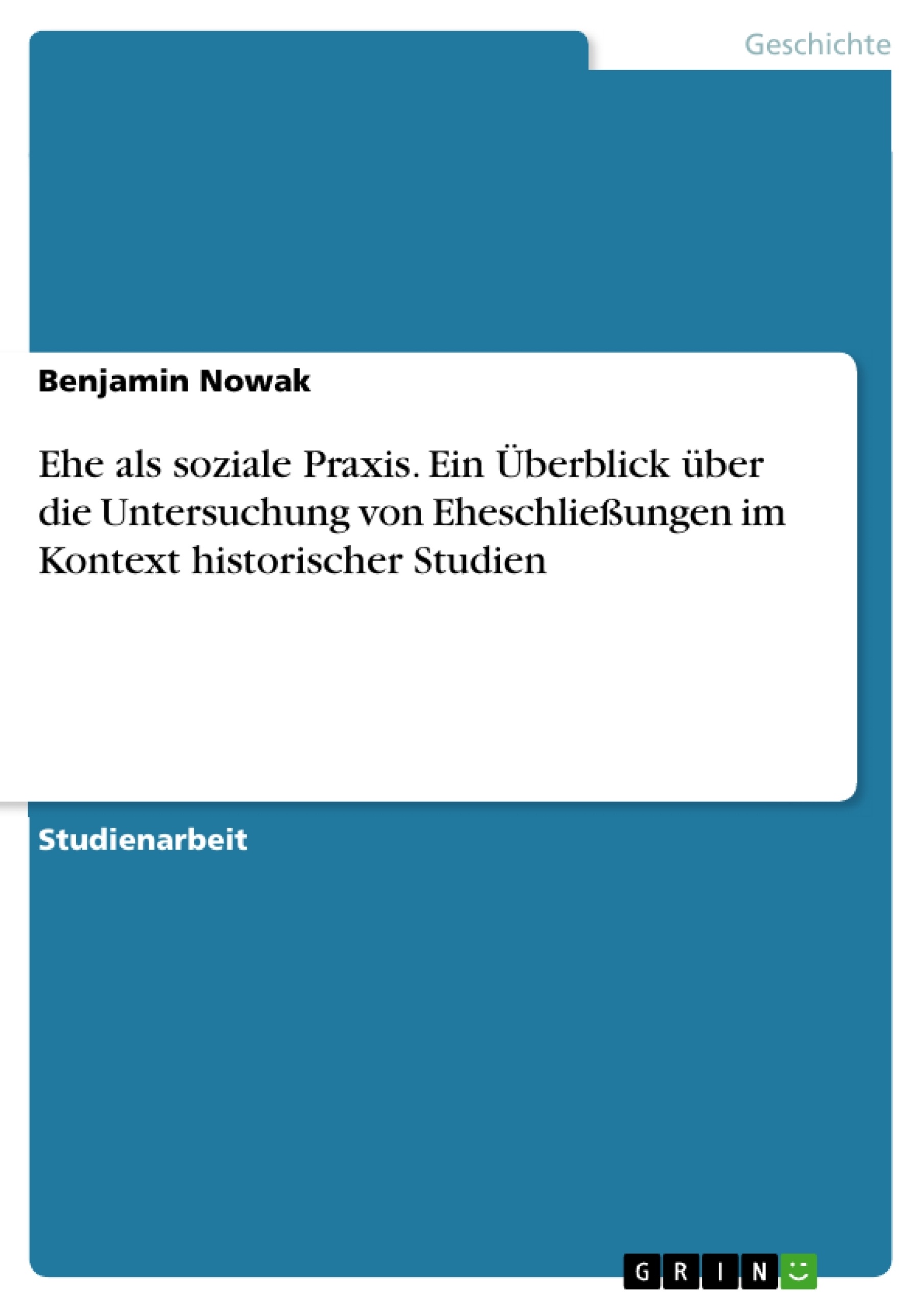„Wer sich die Ehe vornimmt, handelt sich eine Welt ein. Die der Politik und der Ökonomie und die der Phantasie, die der Köpfe und die der Herzen“, konstatiert Caroline Arni ihre äußerst anregenden Untersuchungen über die "Krise der Ehe um 1900". Und in der Tat beschäftigt die Frage, wer wen warum oder warum auch nicht heiratet seit geraumer Zeit die Gesetzgeber, Literaten, Wirtschaftswissenschaftler und Vertreter der verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen.
Sich einen Überblick über die Thematik, die auf den ersten Blick als eine sehr einfache, weil allgegenwärtige erschien, zu verschaffen, dauerte ein reichliches Jahr, indem mehrere hundert Literaturtitel konsultiert wurden. Die Allgegenwart des Themas ist es schließlich auch, die eine Fülle von Zugängen anbietet. Sinnbildlich steht man als Wanderer an einem Wegekreuz in weiter (Forschungs-) Landschaft: dutzende Wege führen zu dutzenden Sehenswürdigkeiten, doch keiner führt an allen entlang.
Einen Einblick oder, um bei der Metapher zu bleiben, einen ‚Reiseführer‘ zu bieten, ist das Anliegen dieser Arbeit. Selbstredend kann dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.
Die folgenden Ausführungen stehen dabei in einem weiteren Kontext: Der empirischen Untersuchung des Heiratsverhaltens bzw. der Eheschließungen in einer deutschen Großstadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also in einer Zeit rasanten wirtschaftlichen Wachstums, der Urbanisierung, der massenhaften Migration und Mobilität. Es wird in diesem Gesamtkontext zu untersuchen sein, wer wen heiratete, das heißt, welche Determinanten das Heiratsverhalten bestimmten: Beruf, soziale Lage, Konfession, Alter sowie soziale und geografische Herkunft etc. Darüber hinaus sollen neben diesen quantitativen auch qualitative Zugänge genutzt werden, um Ehe als soziale Praxis begreifbar zu machen. Die Literaturlage ist, wie bereits angedeutet, diesbezüglich sehr ergiebig.
Ziel ist es, einen umfänglichen Einblick einerseits in die Forschungslage und aktuelle Fragestellungen zu gewinnen, andererseits über theoretische und praktische Zugänge zur Thematik Anregungen für eigene Untersuchungen zu erfahren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Ehe als Institution zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Ein Exkurs zur Entwicklung des Eherechtes und der Eheauffassung im Preußen des 19. Jahrhunderts
2.1. Institutionen
2.2. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten
2.3. Das Bürgerliche Gesetzbuch
2.4. Folgerungen
2.5. Zusammenfassung
3. Ehe und Familie als Forschungsthemen. Ein Abriss
4. Ehe als soziale Praxis. Deskriptive und analytische Zugänge
4.1. Soziale Platzierung, soziale Praxis und soziale Gruppen. Eine Hypothese zur Wirkweise von Ehe als sozialer Praxis
4.2. Forschungszugänge
4.2.1. Muster und Strategien
4.2.2. Struktur und Kultur im Wechselspiel: äußere Gegebenheit und innere Dispositionen.
4.2.3. Faktoren und Tendenzen. Ehen und soziale Lagen
5. Fazit
6. Quellen- und Literaturverzeichnis