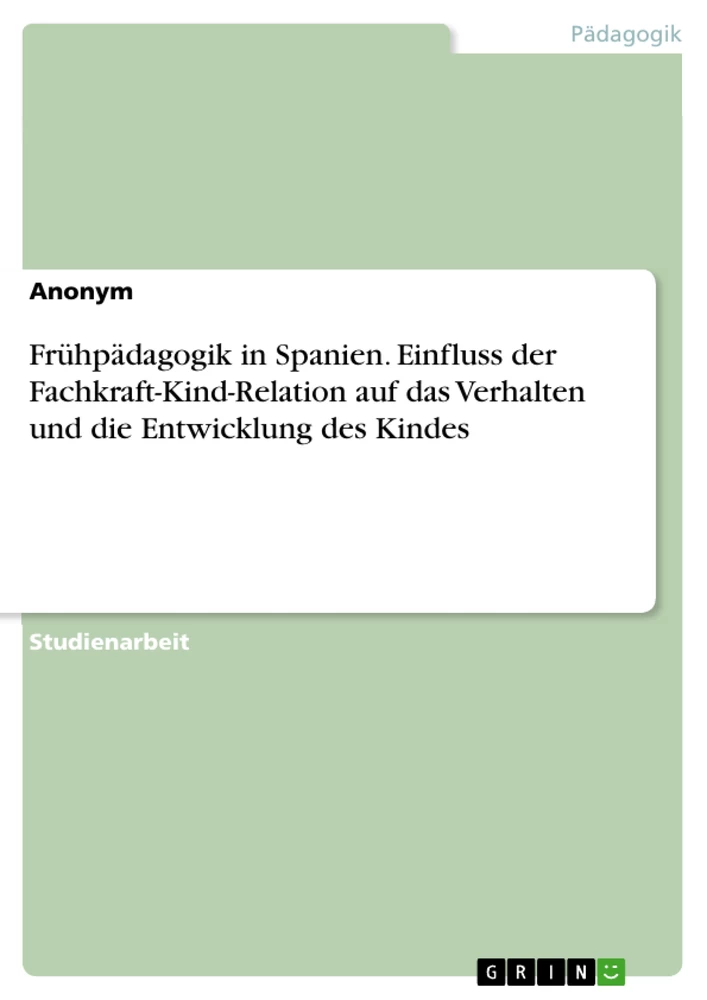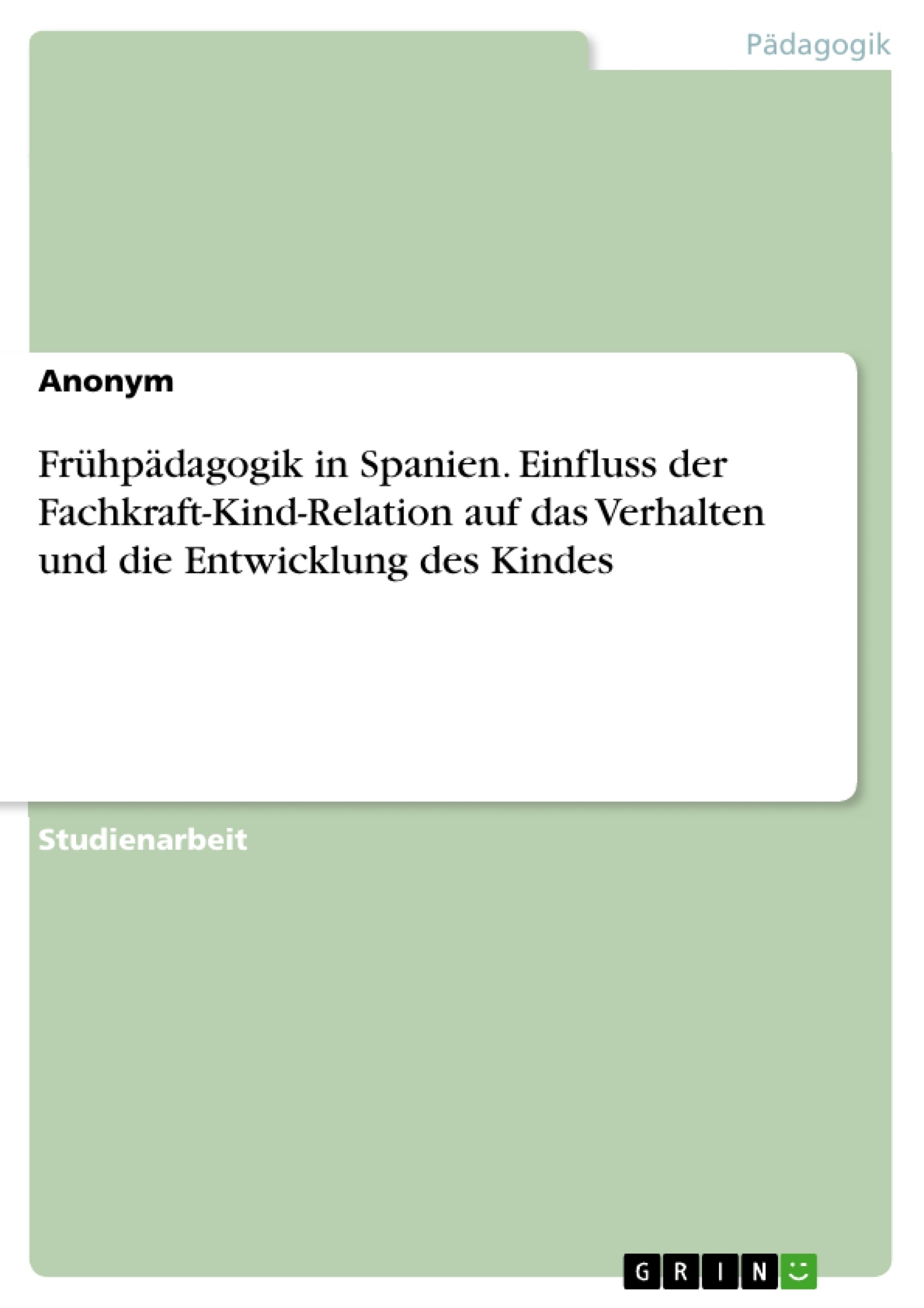Obwohl Europa immer mehr zusammenwächst, sind dennoch in den einzelnen Ländern verschiedene Traditionen und auch verschiedene Erziehungs- und Bildungssysteme zu verzeichnen. Im Rahmen einer europäischen Perspektive ergeben sich daher zahlreiche Fragen: Welche Tageseinrichtungen gibt es in den verschiedenen Ländern? Wie ist die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte gestaltet? Stehen eher Bildungs- oder Betreuungsaufgaben im Vordergrund? Welche Fachkraft-Kind-Relation ist zu verzeichnen?
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weist beispielsweise Spanien eine sehr hohe Fachkraft-Kind-Relation auf, d.h. eine geringe Anzahl von Erzieherinnen betreut relativ viele Kinder gleichzeitig. Da es spätestens mit drei Jahren für fast alle Kinder in Spanien selbstverständlich ist, einen kleinen oder großen Teil des Tages in einer Kindertageseinrichtung zu verbringen, ergibt sich die Frage, ob die dort vorherrschende hohe Fachkraft-Kind-Relation in Kindertageseinrichtungen (null bis sechs Jahre) Einfluss auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes hat.
Um diese Fragestellung beantworten zu können, werden zunächst einige einleitende Informationen zu Spanien und dem dortigen Erziehungs- und Bildungssystem gegeben. Nach dem Vergleich der Fachkraft-Kind-Relationen einiger europäischer Länder werden Resultate aus Längsschnittstudien vorgestellt, welche Bezug zu den Einflussmöglichkeiten der Fachkraft-Kind-Relation auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes nehmen. Abschließend wird erörtert, ob bzw. inwieweit diese Forschungsergebnisse auf das frühpädagogische Bildungssystem Spaniens übertragbar sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einleitende Informationen zu Spanien und der dortigen Frühpädagogik
3. Fachkraft-Kind-Relation
3.1 Europäischer Vergleich
3.2 Einfluss auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes
4. Fazit
5. Literatur- und Quellenverzeichnis