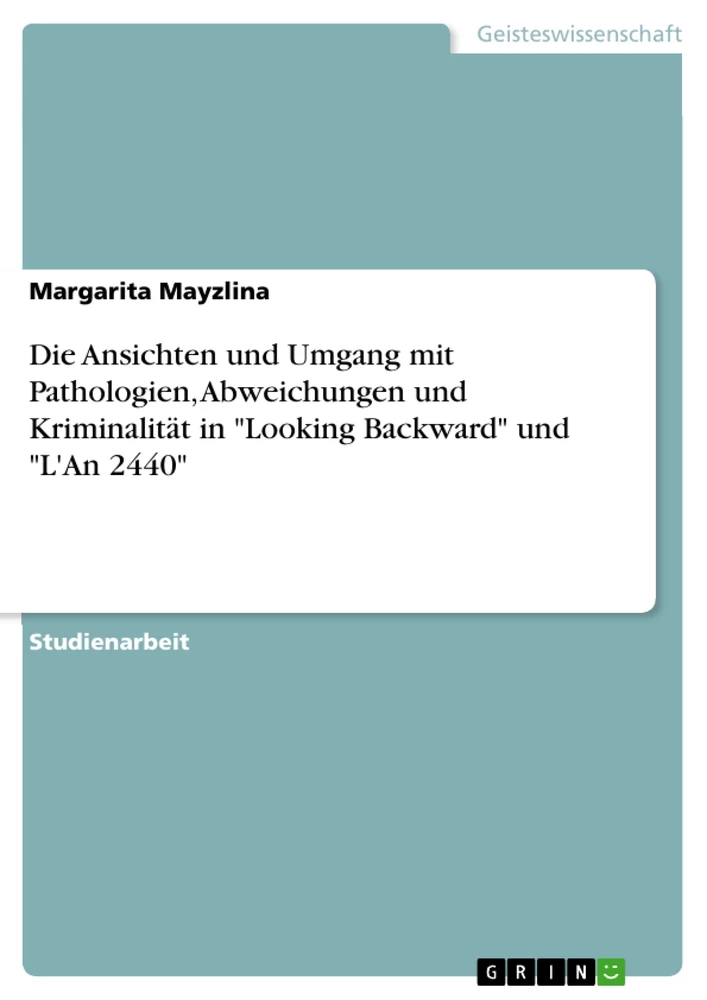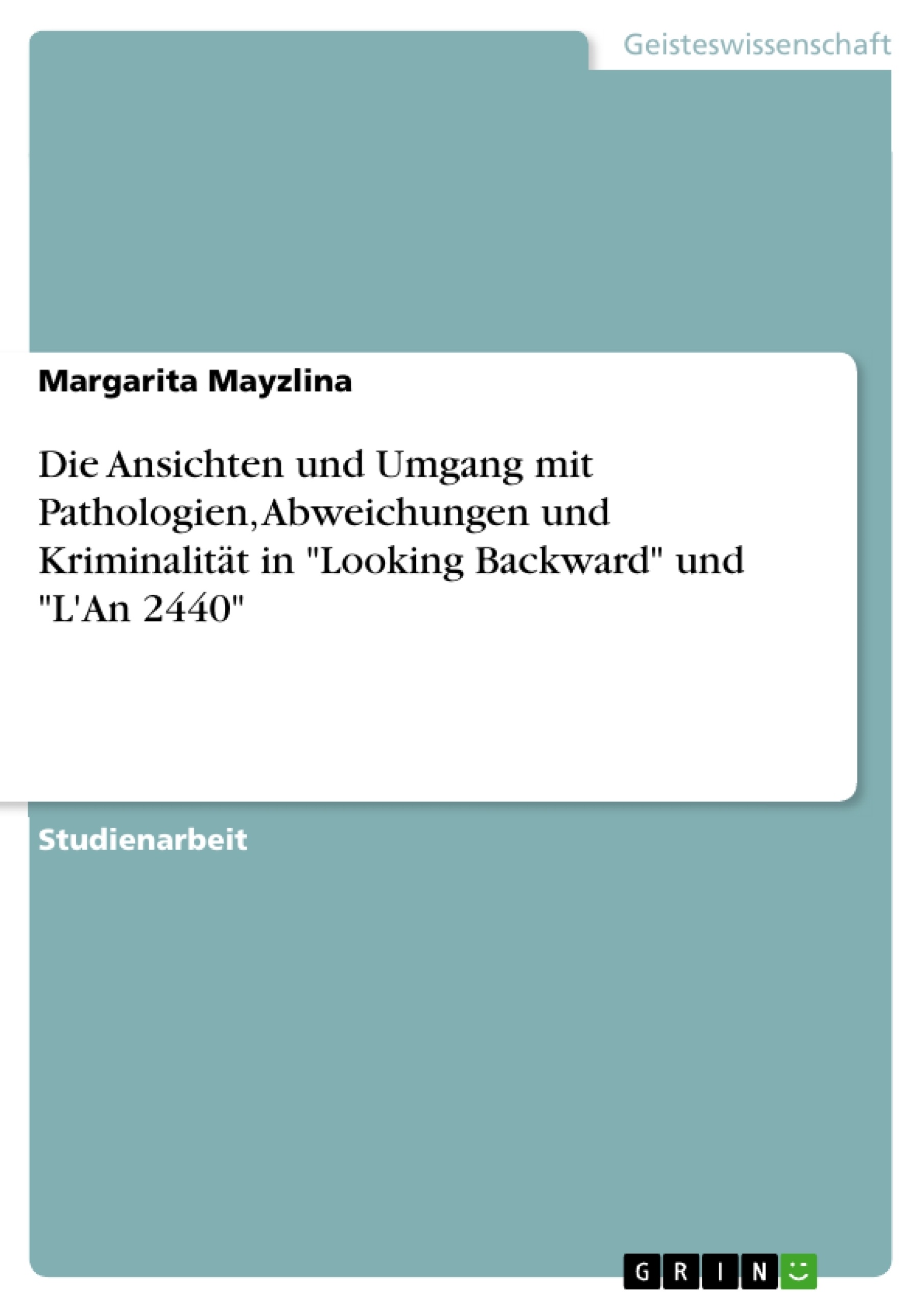„L'An 2440“ von Louis-Sébastien Mercier gilt als „only the fifth secular book of any kind set in future time“ und als erste Utopie, deren Existenz nicht durch Entdeckung eines neuen Ortes, sondern durch einen Sprung in der Zeit erforscht und begründet wird. Es ist also eine „Zukunftsutopie (Uchronie)“ und zugleich ein Ausweg aus einer gattungsgeschichtlichen Sackgasse. Denn der Globus zeigt Ende des 18. Jahrhunderts kaum noch weiße Flekken [sic] […] ehe man mit der Hereinnahme der Zeitdimension der utopischen Phantasie ein neues, prinzipiell unerschöpfliches Reich eröffnete.
Interessanterweise wird der Roman von manchen als „Zeitutopie“ bezeichnet, Jürgen Fohrmann drückt sich aber explizit dagegen aus. Mercier war ein großer Anhänger der Ideen und Ideale Voltaires und Rousseaus, wurde sogar als >>Affe Rousseaus<< (le singe de Rousseau) bezeichnet. Merciers Gedanken waren – für seine Zeit erst recht – fortschrittlich und mutig, sie erregten großen Ärger, weshalb das Buch, nachdem es 1771 in Amsterdam erschienen worden war, in Frankreich sofort und in Spanien im Jahr 1778 verboten wurde. Die katholische Kirche verurteilte den Roman scharf und es war selbst den Personen, die verbotene Bücher lesen durften, strengstens untersagt, dieses zu lesen.
„Looking Backward“ von Edward Bellamy wurde im Januar 1888 von dem Verlag Ticknor in Boston veröffentlicht und erschien in zweiter Auflage im Verlag Houghton/ Mifflin. Das Manuskript schien zwar „dazu angetan zu sein, jede Leserschaft zu verärgern“7 doch war es nur eines von vielen Traktaten und Texten, die Kritik an der Gesellschaft und den Umständen übten und Vorschläge zu einer Veränderung bzw. Verbesserung beitrugen. Nach einer Periode der Stagnation wurde das Buch dennoch weit bekannt und viel gelesen. Auch über die Umstände der Veröffentlichung lässt sich viel in Erfahrung bringen. Es sei so viel gesagt, dass es eine „einfache Antwort“ ist, dass „Looking Backward eine angemessene und seit langem erhoffte Reaktion auf die verwirrenden Zeiten in den Industrienationen war.“ Doch viele andere Faktoren – auch aus Bellamys privatem Leben – spielten eine Rolle. In dem Artikel „How I Came to Write Looking Backward“, welchen Bellamy im Mai 1889 für den Nationalist magazine verfasste, schreibt er, dass seine Idee anfangs „of a mere literary fantasy, a fairy tale of social felicity“war und „It was not till I began to work out the details of the scheme...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Intention der Hausarbeit
2. Skizzierung der Begriffe - mit Bezug auf die zwei utopischen Gesellschaften
2.1„normal“
2.2 „anders“
2.3 „pathologisch“
3. Looking Backward von Edward Bellamy
3.1 Der Umgang mit Schwachen und Kranken
3.2 Die Gedanken über Kriminalität und Verbrecher
4. L'An 2440. R ê ve s'il en fut jamais von Louis-Sébastien Mercier
4.1 Der Umgang mit Schwachen und Kranken
4.2 Der Umgang mit kriminellen Taten und Tätern
4.3 Die Behandlung der andersdenkenden Personen
5. Schluss: Fazit und Ausblick in die Zukunft
6. Bibliographie und Quellen