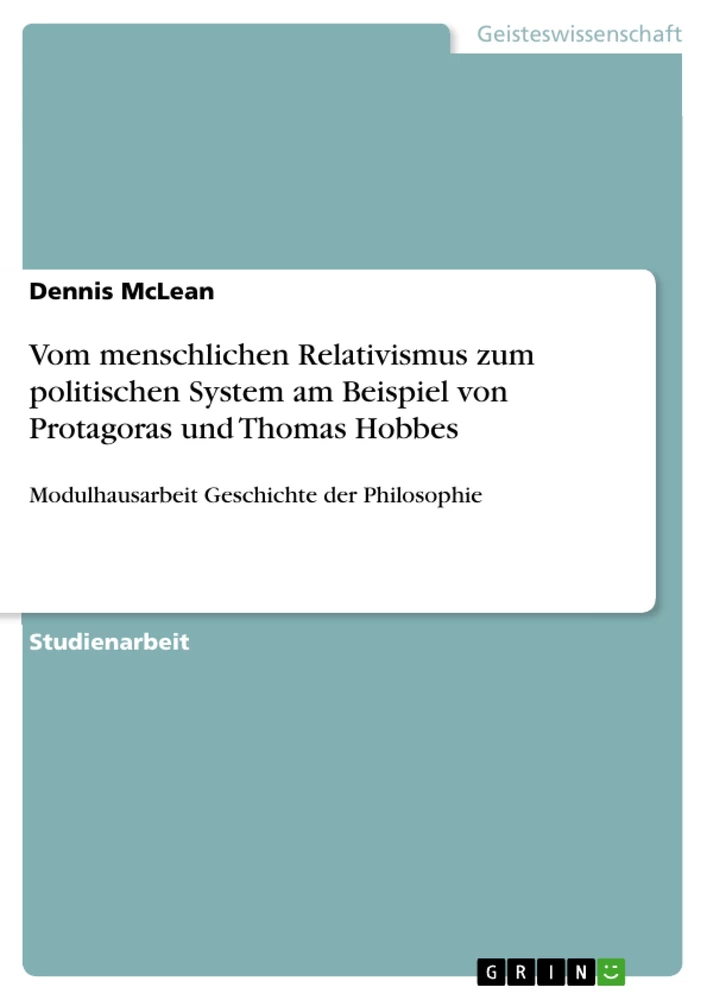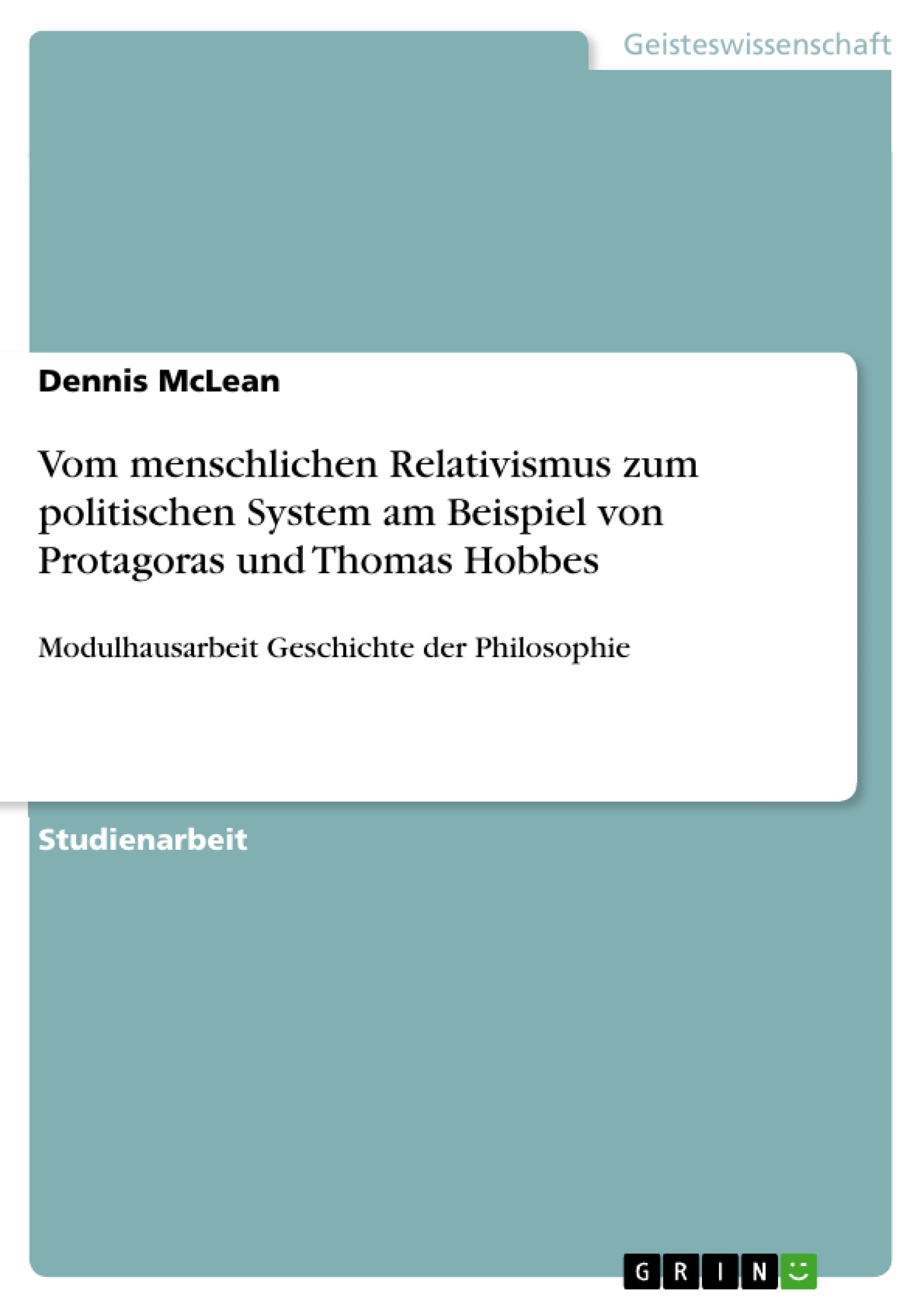Wenn wir die Welt betrachten, halten wir die Dinge, die wir sehen, fühlen, schmecken oder riechen, für wahr. Das bedeutet, dass jemand, der sich nicht gerade mit philosophischer Erkenntnistheorie beschäftigt, wohl kaum soweit gehen würde, die Welt, so wie er sie wahrnimmt, als Maßstab für eine objektive Wahrheit anzuzweifeln. Doch wer sagt uns, dass das, was man von der Welt wahrnimmt auch genauso existiert, wie man es wahrnimmt? Diese Frage ist ein großer Streitpunkt in der Philosophie und es gibt eine Vielzahl von Lösungsansätzen wie Relativismus, Rationalismus, Empirismus, Idealismus oder Materialismus und nicht zuletzt wird auch in den Naturwissenschaften versucht, dieses Problem zu lösen.
Wann kann man also sagen, dass die Dinge, die wir sehen, fühlen, riechen, schmecken oder hören, also die Aufnahme von Eindrücken über unseren Sinnesapparat, ein objektives Erkennen der Welt1 garantieren? Wenn die Art und Weise, mit der wir die Welt sehen, Gerüche wahrnehmen, Töne hören und Farben sehen, die einzige ist, mit der wir es schaffen, einen Zugang zur Welt zu erlangen, dann ist auf keinen Fall sicher, dass diese Art und Weise auch die richtige ist, um eine objektive Wahrheit darüber zu schaffen, wie unsere Welt tatsächlich ist.
Kann ein objektives Erkennen von Wahrheit für die Menschen dann überhaupt möglich sein? Und wenn ein Zugang zu objektiver Wahrheit nicht möglich ist, was ist dann das, was wir als Wahrheit bezeichnen? Nach Protagoras ist der Mensch das Maß aller Dinge und damit derjenige, der festlegt was als Wahrheit gilt – ganz unabhängig vom objektiven Charakter dieser Wahrheit. Dies bezieht sich nicht nur auf das Wahrnehmen von Dingen in der Welt, sondern auch auf Glaube, Ethik und Moral. Die Ansichten, Meinungen und Einstellungen der Menschen sind damit relativ und nichts von Natur gegebenes oder Absolutes.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Protagoras - Erkennen der Welt
3. Protagoras - Demokratie als politisches System
4. Thomas Hobbes - Erkennen der Welt
5. Thomas Hobbes politisches System - Der Leviathan
6. Fazit
7. Literaturliste