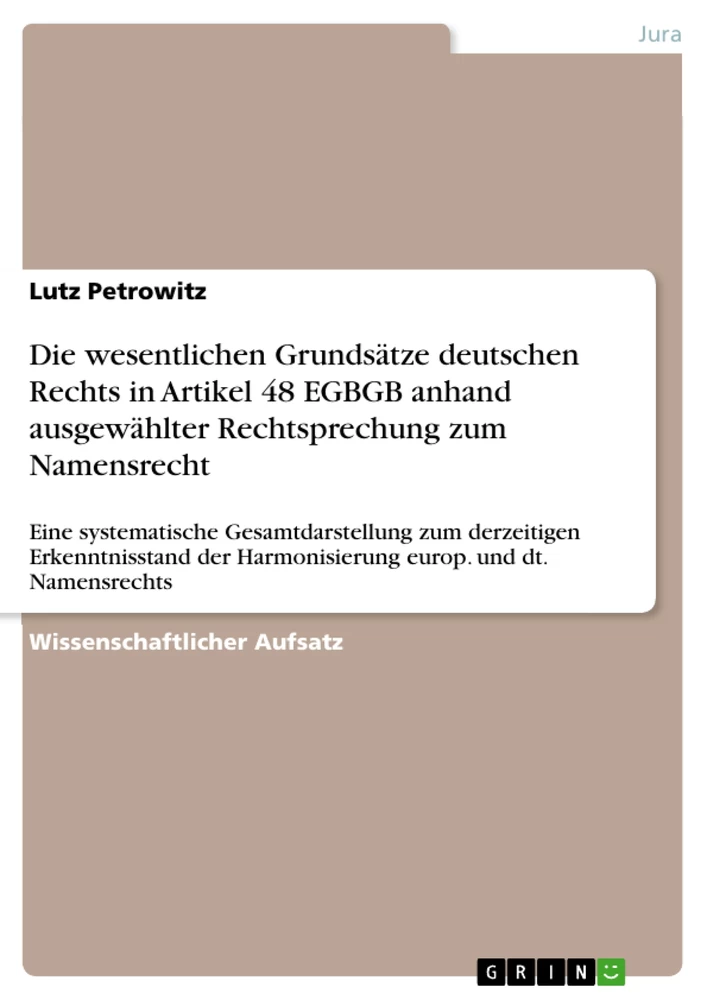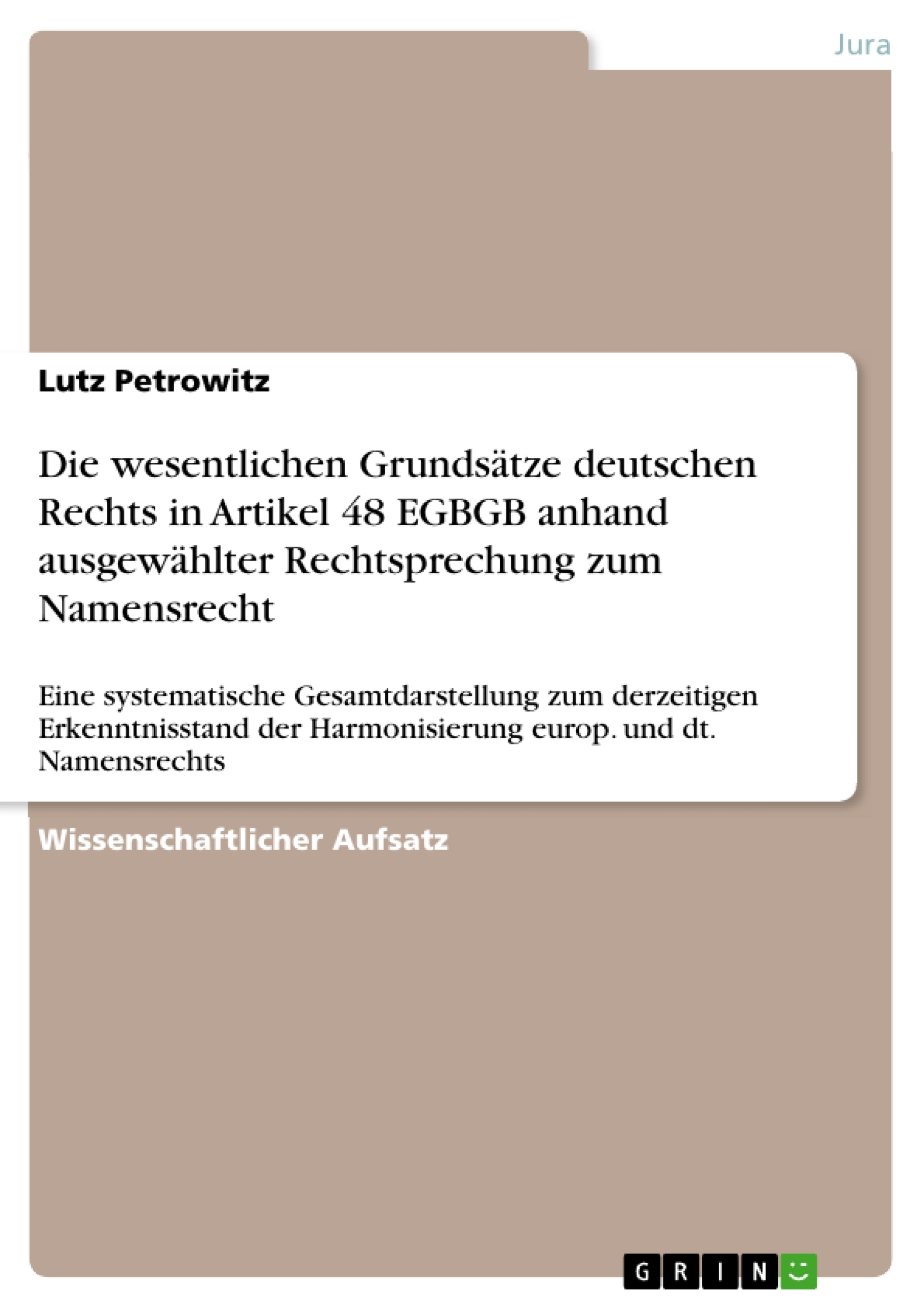Mit der Denkschrift »Artikel 48 EGBGB und Wesentliche Grundsätze deutschen Rechts« setzt der Autor einen Gedankenanstoß zur Harmonisierung des europäischen Gedankens auch und gerade im Zivilrecht und Namensrecht. Anhand einer exemplarischen Bestandsaufnahme zu den bisher aus der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen im Namensrecht sollen Antworten zu Fragestellungen aus den Praxisbereichen gegeben werden.
Die vielfältigen fortgeschrittenen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Europa, die Auswirkungen des Namens als Identifikationsmerkmal und das neue Namensrecht im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) verlangen nach einer grundsätzlichen neuen Umgangsweise bei der Umgestaltung der auch im Namen zu vereinenden Familie.
Die Denkschrift »Artikel 48 EGBGB und Wesentliche Grundsätze deutschen Rechts« wird vorgelegt, um den Dialog und die juristische Disputation mit der Fachöffentlichkeit, mit Verwaltung und den betroffenen Familienmitgliedern anzuregen und um Argumente für Reformschritte auf europarechtlicher Angleichungsebene zu bereichern.
Verbunden mit dieser Denkschrift ist die Hoffnung, dass durch sie die europarechtliche Harmonisierung von Reformen im Personenstandsrecht befördert wird und der Gesetzgeber und die Fachgerichte zu raschen Weichenstellungen und notwendigen Initiativen veranlaßt werden.
Gliederung
Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung dieser Denkschrift
Einleitung
Gesetzestext
Problemstellung
1. Kapitel
1. Wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts nach der Gesetzgebungsintention
1.1 Stellungnahme
1.2 Heranziehung ordre public zwischen EU-Mitgliedsstaaten
1.3 Weitere herzuleitende wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts aus anderen Gesetzen (sondergesetzliche Kollissionsnormen)
2. Wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts und deren Verhältnis zu rechtsstaatlichen Grundsätzen
3. Weitere herzuleitende wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
4. Wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts anhand der BGH-Rechtsprechung
4.1 Grundsatz der öffentlichen Beglaubigung / Beurkundung
4.2 Grundsatz Verbot der révision au fond & Grundsatz des Schutzes [nur] des Kernbestandes der inländischen Ordnung
4.3 Grundsatz der Freizügigkeit und Selbstbestimmung
4.4 Das Prinzip der Namenskontinuität
4.5 Grundsatz der Einheit der Familie und einheitlicher Name
4.6 Ordnungsfunktion des Namens
4.7 Identifikationsinteresse.
4.8 Grundsatz der Namensfreiheit
5. Weitere wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts anhand ausgewählter OLG-Rechtsprechung
5.1 Grundsatz Geburtsname ist unveränderlich, Familienname ist abänderbar
5.2 Grundsatz des Namensquorum „§ 1355 III BGB ist abschließend“
5.3 Keine Phantasienamen, Abstammungslinie nachzeichnend, Name historisch belegbar und Familie verbindend, ordre public
6. Wechselwirkung zwischen Namensänderungsrecht und Ehename
6.1 Europarechtlicher Anwendungsvorrang im Personenstandsrecht
6.2 Kein Ehenamensschutz bei Eheaufhebung (§ 1313 BGB)
6.3 Ehenamen-Bindestrich-Entscheidung
6.4 Grundsatz von Treu und Glauben im Personenstandsrecht (§ 242 BGB)
6.5 Zeitschranke des Artikel 48 EGBGB
7. Wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts und zum ordre publik nach erstinstanzlichen Entscheidungen
7.1 Geburtsname und zusätzliche „Adelsprädikate“
8. Internationales Privatrecht
8.1 Sinn und Zweck Entscheidung
8.2 Hinkendes Namensverhältnis
2. Kapitel
1. Offensichtliche Unvereinbarkeit
3. Kapitel
1. Antragstellung nach Artikel 48 EGBGB
MUSTER der Erklärung
2. Standesamtliche Bescheinigung zur Antragstellung nach Artikel 48 EGBGB
MUSTER einer Bescheinigung
Schlussbetrachtung
Literaturnachweis