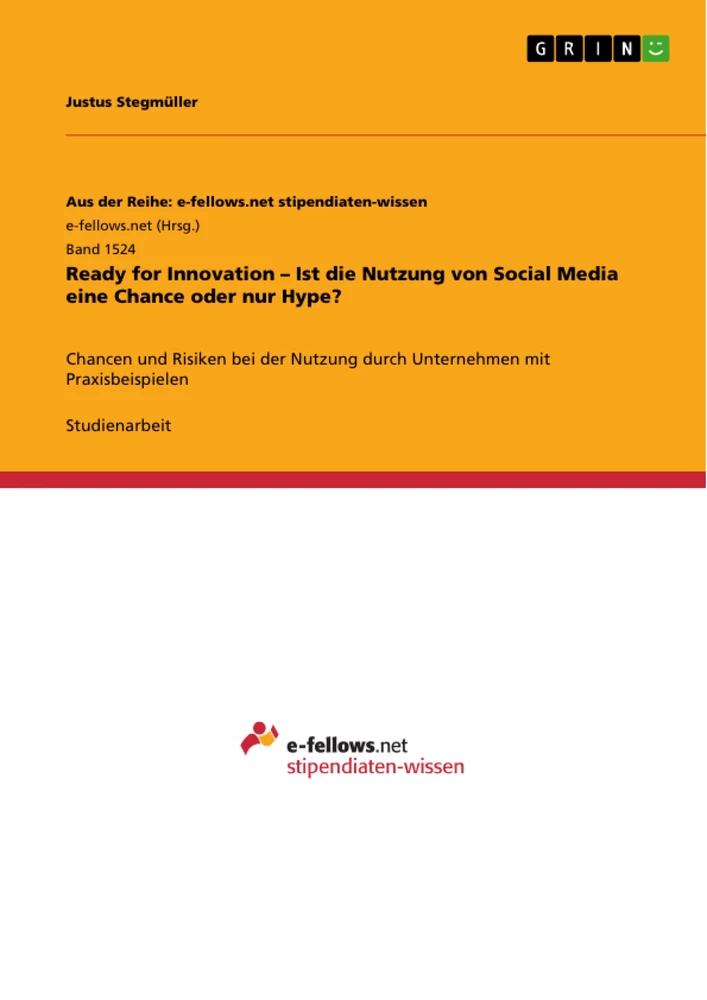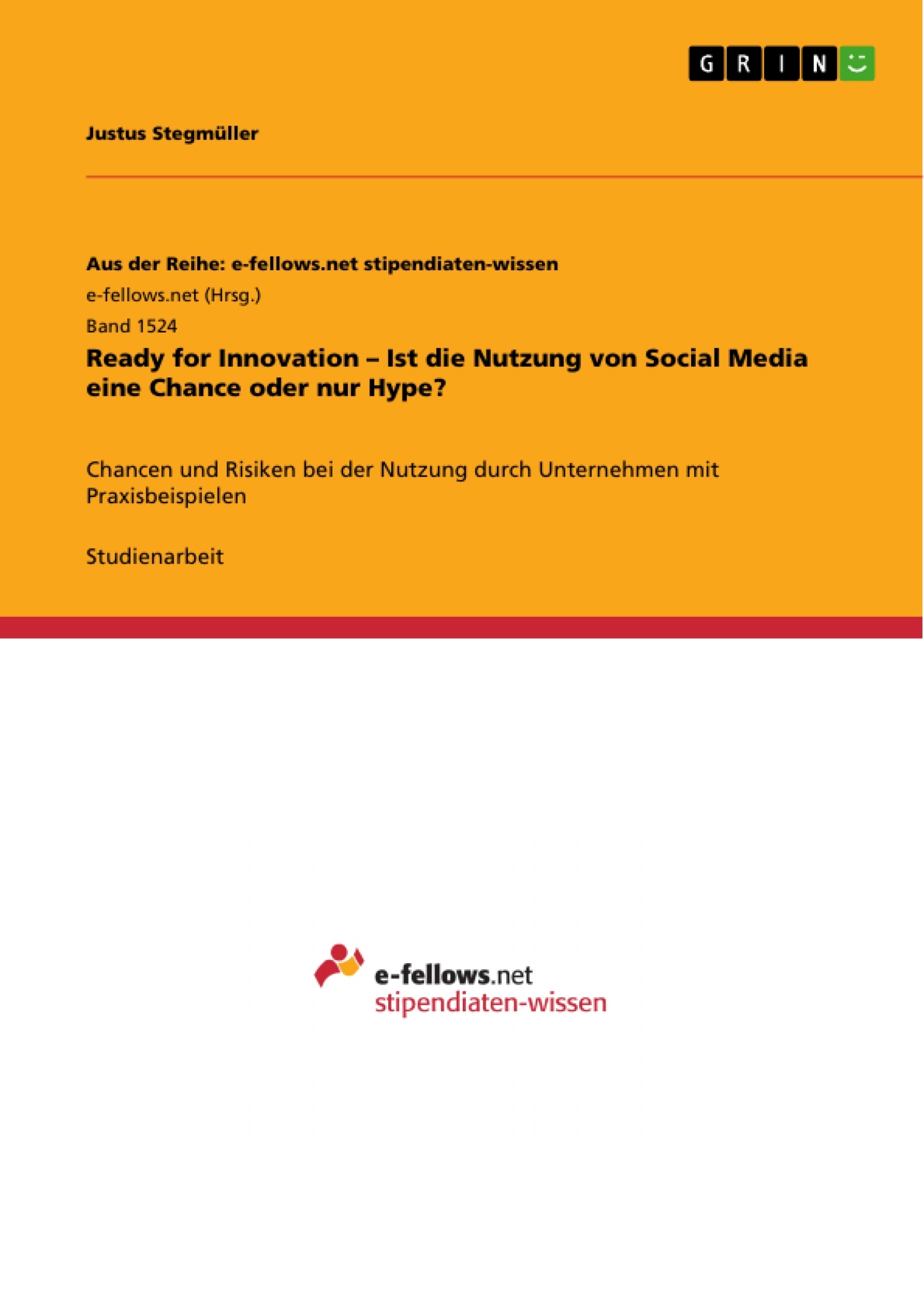Milliarden Menschen surfen täglich im Internet und in Social Media. Im ersten Quartal 2015 nutzten beispielsweise 936 Millionen Nutzer innerhalb von 24 Stunden die Social-Media-Plattform Facebook, etwa 40% mehr als im Jahr 2013. Dementsprechend ist es angemessen zu sagen, dass Social Media einen neuen Trend repräsentieren, der nicht nur für die Unternehmen, die bereits im Internet mitwirken, nutzbringend sein kann. In einer repräsentativen Studie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. gaben jedoch nur 38% der befragten deutschen Unternehmen im Jahr 2014 an, dass sie aktiv Social Media nutzen. Daraus ergibt sich die Frage, ob die restlichen Unternehmen Social Media nicht verwenden, da Social Media für sie nicht nutzbringend ist und gegebenenfalls als Hype erachtet wird, oder ob diese Unternehmen Chancen nicht nutzen.
Die vorliegende Arbeit erörtert die Forschungsfrage, ob durch die Nutzung von Social Media für Unternehmen Chancen entstehen oder ob es sich nur um einen Hype handelt. Die ermittelten Chancen werden durch Beispiele veranschaulicht und mit korrespondierenden Risiken verglichen. Des Weiteren wird darauf eingegangen, für welche Unternehmen sich Social Media eignen und der Nutzen kritisch hinterfragt. In einem abschließenden Fazit werden nicht nur die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst, sondern weiterhin Implikationen für Forschung und Praxis dargelegt sowie die Relevanz für das Marketing erläutert.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Problemstellung und Übersicht über die Arbeit
2 Theoretische Grundlagen der Arbeit
2.1 Definition des Innovationsbegriffes
2.2 Definition von Social Media
3 Social Media – Chance oder Hype?
3.1 Übersicht über den Stand der Forschung
3.2 Allgemeine Chancen von Social Media
3.3 Chancen und Risiken bei der Nutzung verschiedener Social Media
3.4 Social Media als Hype
4 Schlussfolgerung, Kritik und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis