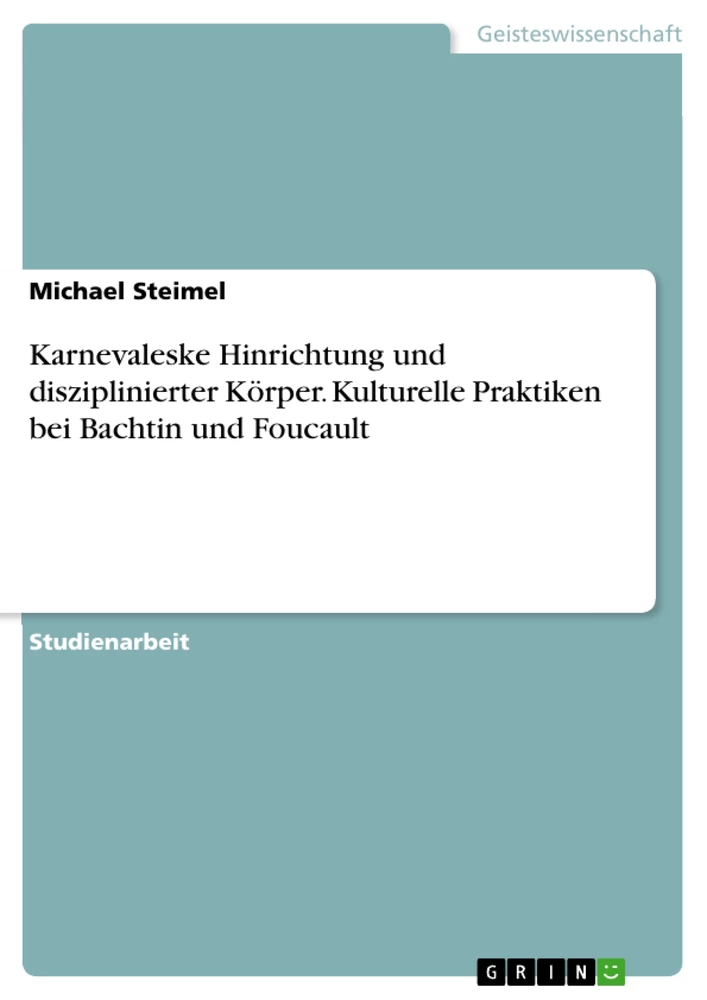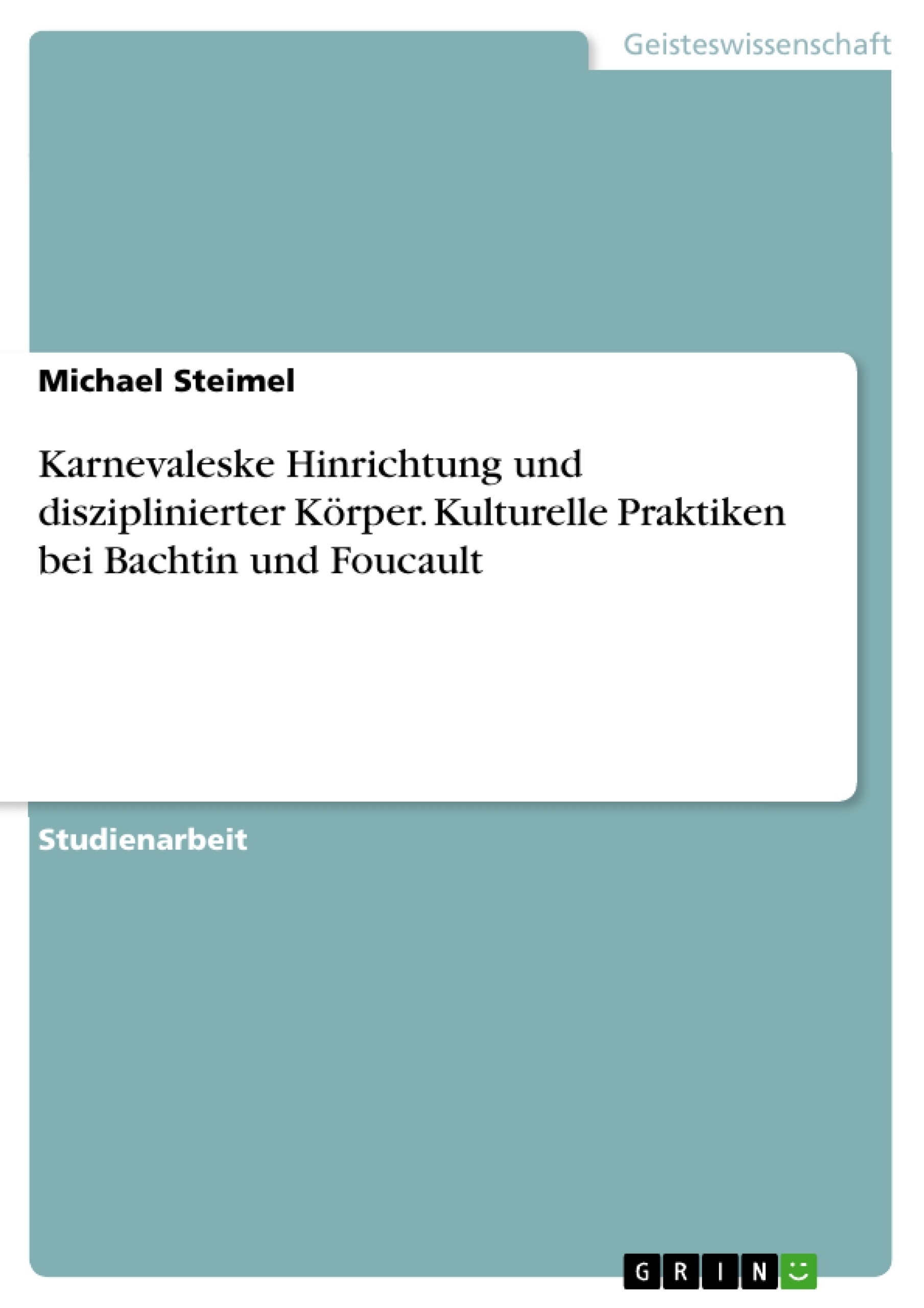Im Ritual der Hinrichtung gibt es, so Foucault, "etwas Karnevaleskes, das die Rollen vertauscht, die Gewalten verhöhnt und die Verbrecher heroisiert". Über die begriffliche Ähnlichkeit hinaus stellt er damit eine semantische Nähe zu Michail Bachtins Konzept des volkstümlichen Karnevals her, der durch die Herabsetzung der religiösen und staatlichen Autoritäten Ambivalenz schafft und gesellschaftliche Hierarchien überwirft.
Das antagonistische Verhältnis der Foucault'schen Disziplinen zu Bachtins Karnevalskultur wird anhand ihrer zentralen Rituale, sowie den ihnen eigenen Körperbildern untersucht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Karnevaleske Hinrichtungen
3. Die Disziplin und ihre Körper
4. Fazit
Literaturverzeichnis