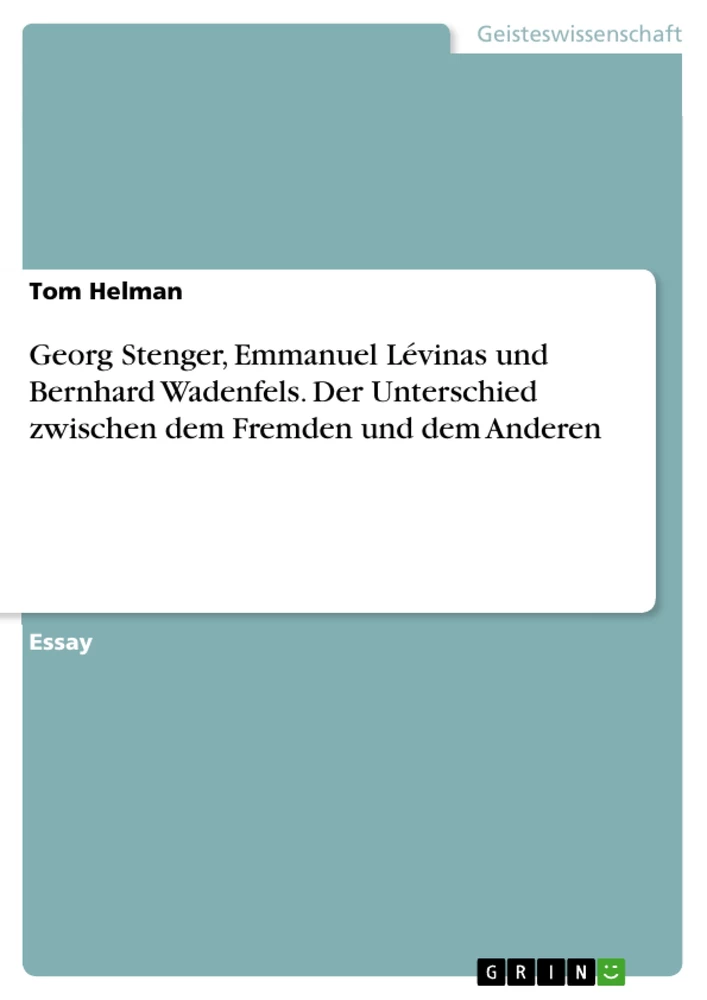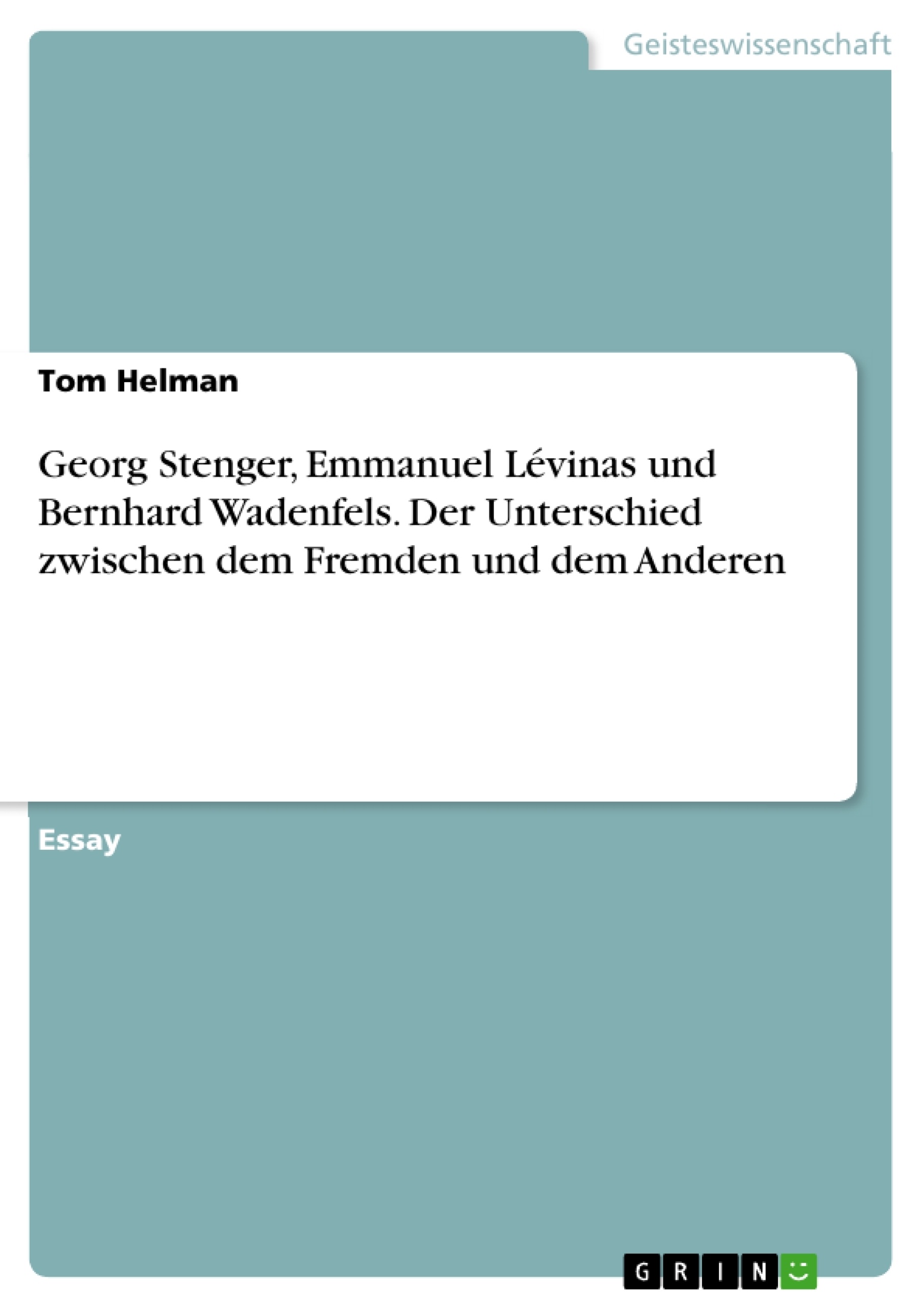Fokus der Arbeit sind Überlegungen von Georg Stenger, die durch Gedanken von Lévinas und Wadenfels ergänzt werden. Vor allem Wadenfels hat sich ausgiebig mit der Fremderfahrung auseinandergesetzt. Zum Schluss sollen die gesammelten Erkenntnisse dazu dienen, eine bessere Unterscheidung zwischen Fremdem und Anderem herausbilden zu können.
Die Fremderfahrung als phänomenologisches Thema ist relativ gut durchleuchtet. Husserl legte hierzu den Grundstein mit seiner 5. Cartesianischen Meditation. Weitere Überlegungen steuerten beispielsweise Sartre und Merleau-Ponty bei. Jedoch gibt es wenig phänomenologische Erkenntnisse zur Unterscheidung zwischen Fremdem und Anderem.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Das Andere bei Lévinas
3. Fremderfahrung nach Wadenfels
4. Fremderfahrung nach Stenger
5. Fremdes und Anderes – Unterschiede
6. Kritische Würdigung
II. Literaturverzeichnis