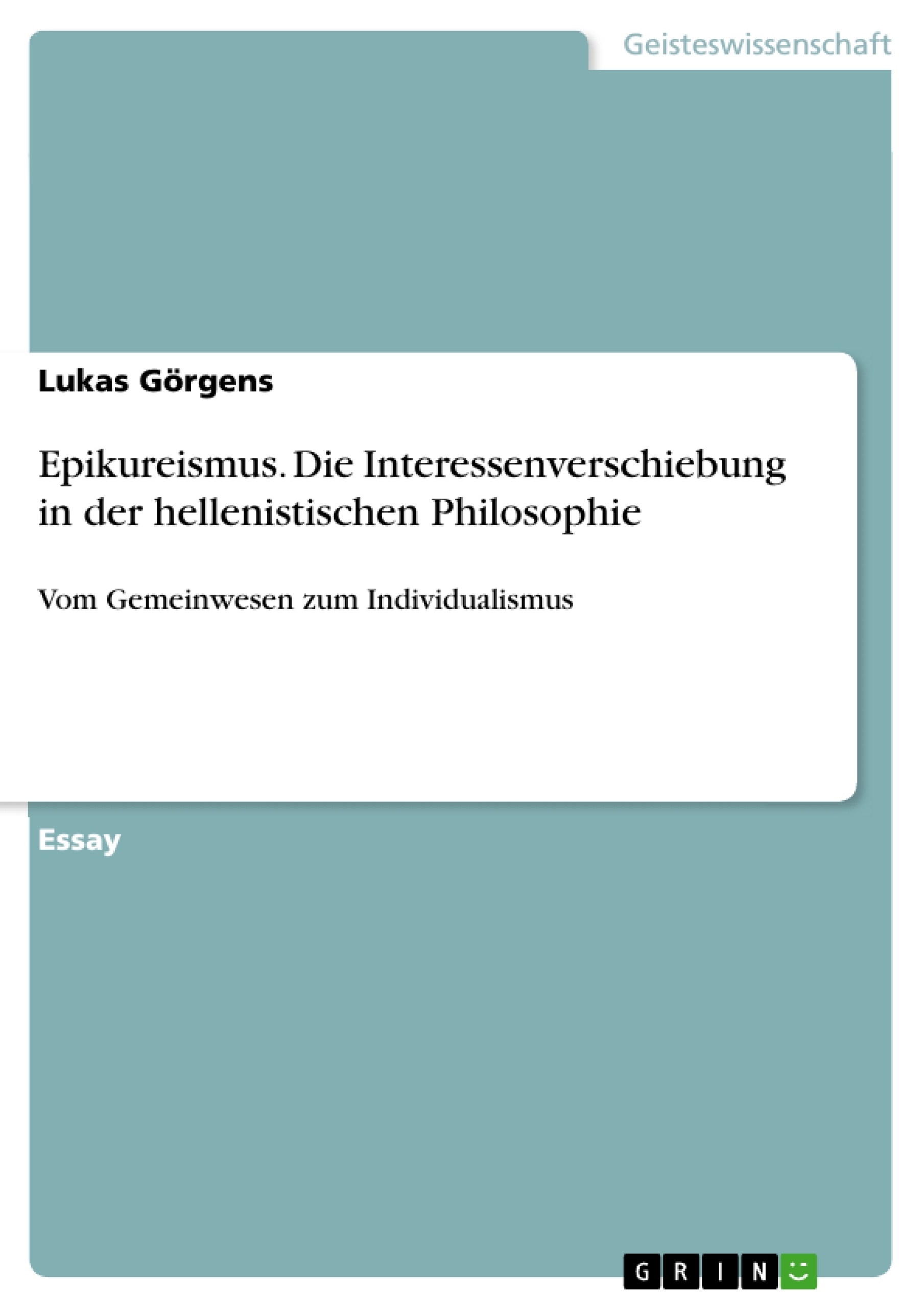Karl Marx ist der Verfasser des Satzes „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ Der Philosoph wollte damit sagen, dass materielle Umstände einen so großen Einfluss auf die Menschen einer Gesellschaft hätten, dass sie deren Denkweise entscheidend beeinflussen würden. Doch ist man dazu berechtigt diese Verknüpfung in ähnlicher Weise auch in der Philosophie herzustellen - also die Entstehung neuer Denkweisen auf äußere Veränderungen zurückzuführen?
Von zahlreichen Wandlungen war besonders die Zeit des Hellenismus geprägt. Nach den Eroberungen Alexanders und dessen Tod 323 v. Chr. weitete sich die griechische Kultur mit dem Entstehen von Diadochenstaaten auf weite Teile des Mittelmeerraums aus. Parallel dazu verlagerte sich in der Philosophie der Fokus von der Gemeinschaft auf das Individuum. Mit dem Stoizismus, Skeptizismus und Epikureismus entstanden gleich drei neue Schulen, die diesen Aspekt betonten und die folgenden drei Jahrhunderte dominieren sollten.
Es stellt sich also die Frage, ob eine Verbindung zwischen den durch Alexander angestoßenen Veränderungen und den neuen Vorstellungen in der Philosophie geknüpft werden kann. Da die drei neuen Richtungen hinsichtlich des genannten Gesichtspunktes viele Gemeinsamkeiten aufweisen, soll im Rahmen dieses Essays exemplarisch nur der Epikureismus genauer betrachtet werden. Um das Neue an dieser Lehre aber überhaupt als solches erkennen zu können, bedarf es zunächst eines Blickes auf die Besonderheiten der vorherigen Zeit.
Epikureismus. Die Interessenverschiebung in der hellenistischen Philosophie
Vom Gemeinwesen zum Individualismus
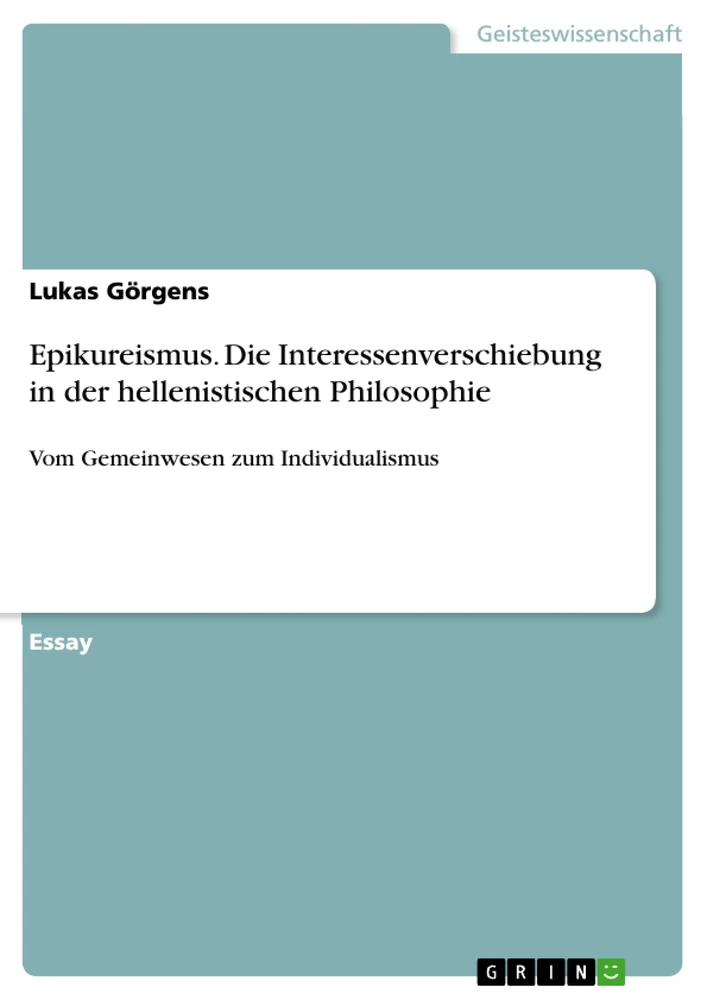
Essay , 2015 , 10 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Lukas Görgens (Autor:in)
Philosophie - Philosophie der Antike
Leseprobe & Details Blick ins Buch