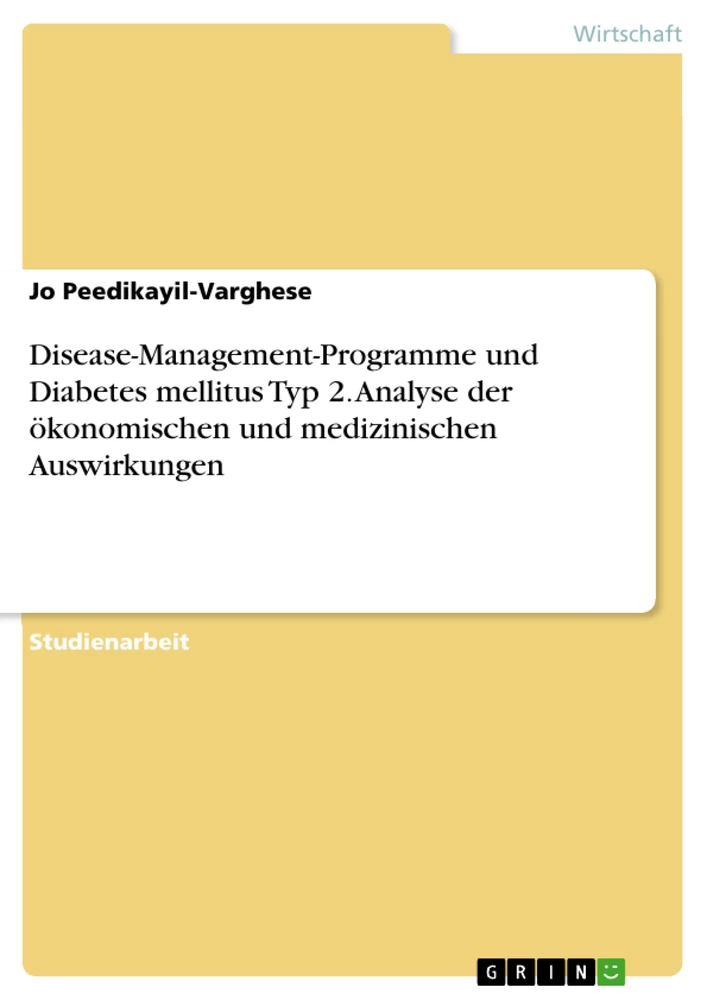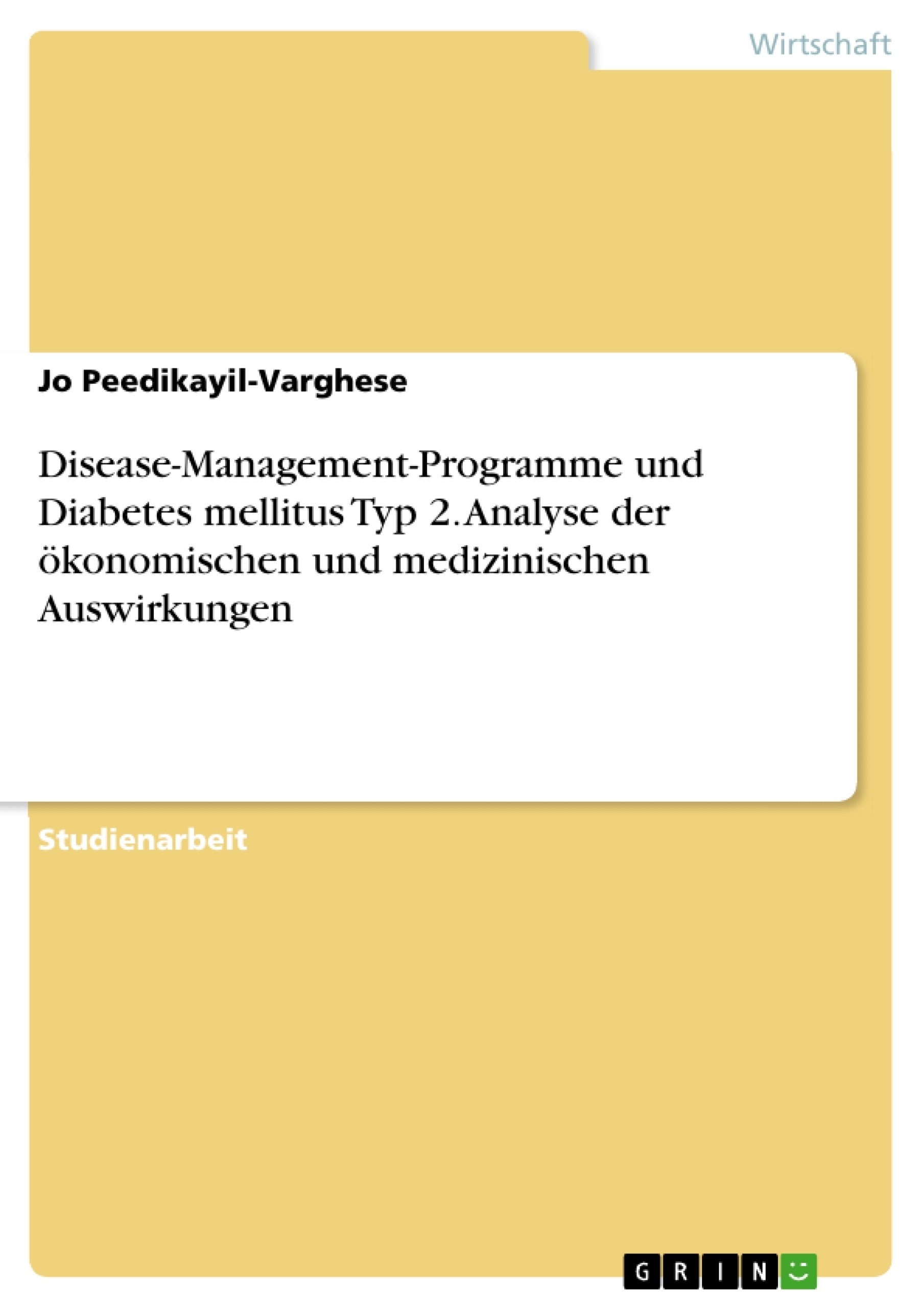Die steigenden Kosten für das Gesundheitssystem, der stärkere Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und der demografische Wandel setzen eine ökonomisch und medizinisch effektive Behandlung der Versicherten voraus. Ein Ansatz um den steigenden Kosten zu begegnen und gleichzeitig eine Verbesserung der medizinischen Behandlung zu gewährleisten, sind die Disease-Management-Programme, abgekürzt DMP.
Fast 5 Mio. Menschen leiden an Diabetes mellitus, die meisten an Typ 2. Ein Großteil dieser Typ-2-Patienten nehmen schon an einem DMP teil. Mit fast 2,7 Mio. Patienten umfasst die DMP mit der Indikation Diabetes mellitus Typ 2 den größten Patientenkreis innerhalb der DMP. Bedingt durch diesen Stellenwert in der Indikationsverteilung befasst sich diese Hausarbeit mit den DMP mit der Indikation Diabetes mellitus Typ 2.
Die Gesundheitsausgaben sind von 1992 bis 2012 um das Doppelte angestiegen. Mit Rücksichtnahme auf die Verschiebung des Spektrums der Krankheiten, welches sich in den letzten Jahrzehnten stark von den akuten Krankheiten zu den chronischen Krankheiten vorschoben hat, rücken chronische Krankheiten immer mehr in den Fokus ökonomischer Betrachtungsweisen. Da fast 2/3 der Todesursachen in Deutschland direkt oder indirekt auf chronische Krankheiten zurückzuführen sind, ist neben der ökonomischen Betrachtung der chronischen Krankheiten auch eine medizinische Betrachtung und einheitliche Behandlungsleitlinien von großer Wichtigkeit.
Um diesem Problem zu begegnen müssen kostengünstige, aber dennoch effiziente Behandlungen für die betroffenen Patienten bereitgestellt werden. Dies sollte 2002 durch die DMP geschehen. In dieser Hausarbeit werden die Auswirkungen der ökonomischen und medizinischen Aspekte analysiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
2 Allgemeine Informationen zu DMP
2.1 Begrifflichkeit und Historie der DMP
2.2 Instrumente und Ziele der DMP
2.3 Entstehung eines DMP
2.4 Finanzierung der DMP über den Risikostrukturausgleich, den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich und den Gesundheitsfond
3 Ökonomische Auswirkungen der DMP anhand der Indikation Diabetes mellitus Typ 2
4 Medizinische Auswirkungen der DMP anhand der Indikation Diabetes mellitus Typ 2
5 Fazit und Ausblick
Anhang A: Unterschiede in den Krankenhausdaten
Anhang B: Positive Veränderung des Bluthochdrucks nach DMP Teilnahme
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literatur- und Quellenverzeichnis