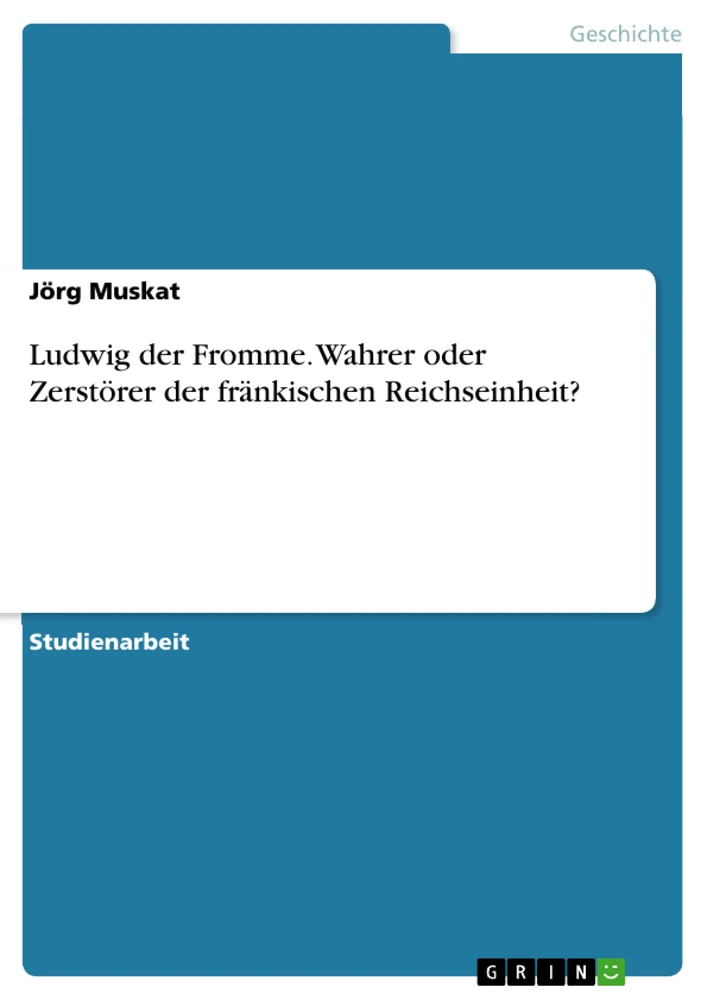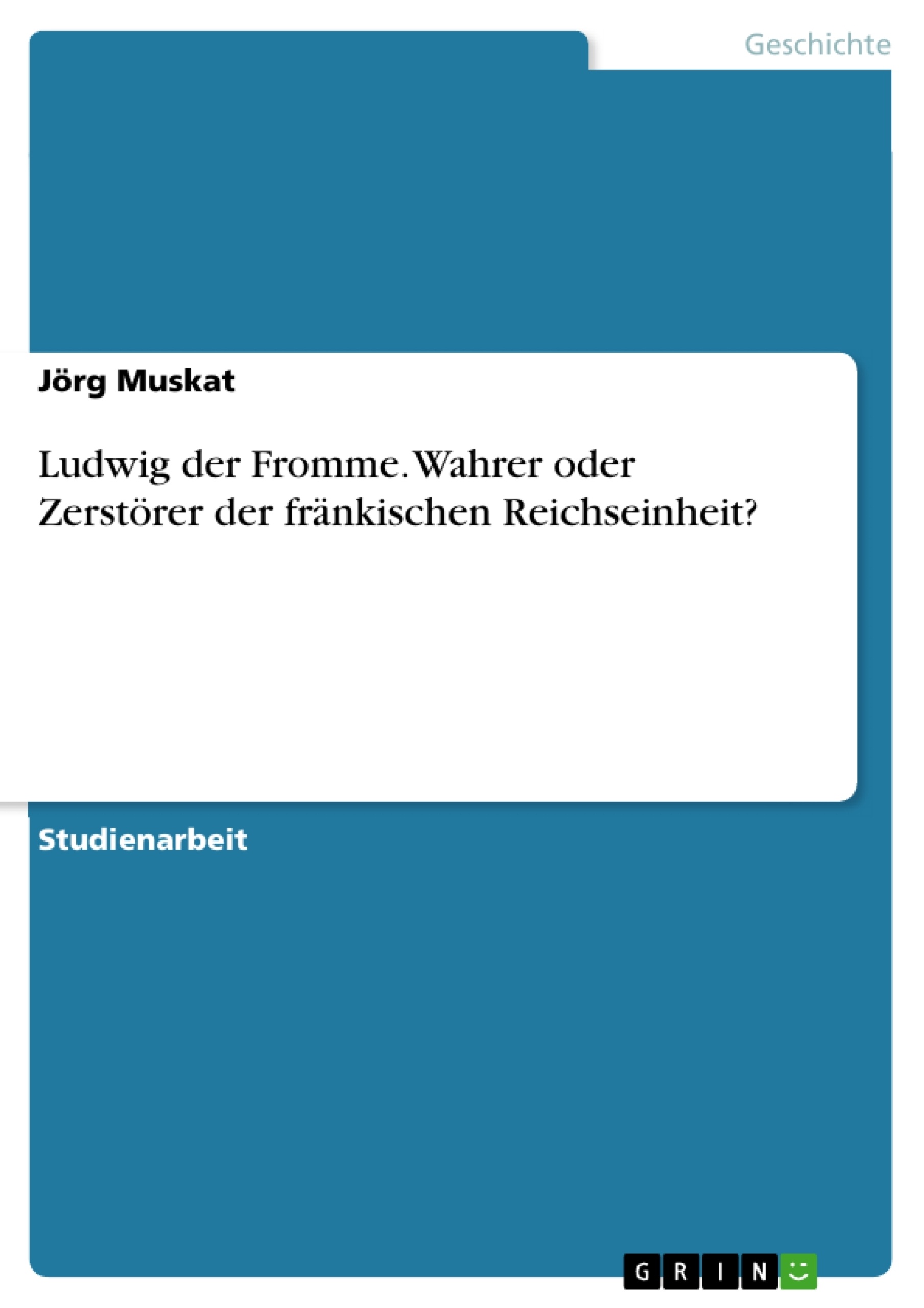Die Jahrzehnte der Regierung Karls des Großen werden heute gemeinhin als die Jahre angesehen, in denen das Frankenreich zu seiner inneren und äußeren Größe fand.
Karl der Große wurde von Zeitgenossen und nachfolgenden Historikern als die alles überragende Herrscherpersönlichkeit dargestellt, die das Reich nach innen einte und nach außen durch Eroberungen vergrößerte.
In seinem großen Schatten stand sein seit 813/14 herrschender Sohn Ludwig der Fromme, nach dessen Herrschaft das Frankenreich unter seine Söhne zerfiel.
Legte Ludwig der Fromme die Grundlage für die spätere Reichsteilung?
Unterstand er zu sehr äußeren Einflüssen, welche ihn ständig zwischen Erbteilung nach fränkischem Brauch und Reichseinheitsidee wechseln ließen?
War er in diesem Zusammenhang zu unsicher und unselbstständig, zu wankelmütig?
Des Weiteren werde ich die Frage erörtern, ob Ludwig der Fromme zu mild, bzw. zu gütig war, ihm dies als Schwäche ausgelegt und er somit ausgenutzt wurde, und ob es ihm überhaupt möglich war, im Vergleich mit Karl dem Großen zu bestehen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung und Fragestellung
2. Die Anfänge als Herrscher über das Frankenreich ab 813/14
3. Die Thronfolgeordnung von 817 (Ordinatio imperii)
4. Beginn der inneren Konflikte im Frankenreich ab 817/18
4.1 Der Aufstand Bernhards von Italien
4.2 Karl der Kahle und die loyale Palastrebellion
4.3 Die zweite Absetzung Ludwigs des Frommen
4.4 Die Schlussphase der Regierung Ludwigs des Frommen 834 - 840
5. Die Bedeutung Ludwigs des Frommen, seine Mitschuld am Niedergang sowie der Teilung des Reiches: Zusammenfassung und Ausblick
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung und Fragestellung
Die Jahrzehnte der Regierung Karls des Großen werden heute gemeinhin als die Jahre angesehen, in denen das Frankenreich zu seiner inneren und äußeren Größe fand. Karl der Große wurde von Zeitgenossen und nachfolgenden Historikern als die alles überragende Herrscherpersönlichkeit dargestellt, der das Reich nach innen einte und nach außen durch Eroberungen vergrößerte.
In seinem großen Schatten stand sein seit 813/14 herrschender Sohn Ludwig der Fromme, nach dessen Herrschaft das Frankenreich unter seine Söhne zerfiel. Legte Ludwig der Fromme die Grundlage für die spätere Reichsteilung? Unterstand er zu sehr äußeren Einflüssen[1], welche ihn ständig zwischen Erbteilung nach fränkischem Brauch und Reichseinheitsidee wechseln ließen? War er in diesem Zusammenhang zu unsicher und unselbstständig, zu wankelmütig?
Des Weiteren werde ich die Frage erörtern ob Ludwig der Fromme zu mild bzw. zu gütig war[2], ihm dies als Schwäche ausgelegt und er somit ausgenutzt wurde, und ob es ihm überhaupt möglich war im Vergleich mit Karl dem Großen zu bestehen:
„Er geriet ganz in den Schatten des großen Begründers des Reiches. Was die Zeitgenossen ihm als Tugenden zugeschrieben hatten, verkehrte sich nun ins Gegenteil: Friedfertigkeit und Milde werden zur Schwäche, monastisch geprägte Tugenden zu törichter Selbstdemütigung, Frömmigkeit wird zur Bigotterie, Freigiebigkeit mit Verschleuderung von Reichsgut gleichgesetzt. Die Abhängigkeit von seiner Umgebung, zumal von seiner Gemahlin Judith, […], erscheint als sein
Verhängnis, als Kennzeichen seiner Schwäche.“[3]
Zuerst werde ich nun einen Überblick über seine Herrschaft bieten, und die durchaus zunächst positiven Reformbestrebungen im Sinne Karls beleuchten. Danach werde ich den Einfluss der Bischöfe und seiner zweiten Frau schildern und versuchen zu zeigen, dass er zeitlebens unter dem Einfluss seiner Berater stand.
Des Weiteren werde ich die Rebellion der Söhne und seine beiden Entmachtungen vorstellen, die zu einem enormen Prestige- und Autoritätsverlust führten.
Ich möchte zeigen, dass er ein frommer Herrscher mit guten Absichten war, dass er es aber schwer hatte aus dem Schatten Karls des Großen herauszutreten. Er war zu gutmütig und fromm und zerbrach letzten Endes an den innerdynastischen Konflikten.
In meiner Arbeit stütze ich mich vor allem auf die Quellen Thegans und des Astronomus. Als Sekundärliteratur arbeite ich hauptsächlich mit Egon Boshofs Biographie „Ludwig der Fromme“, „Die Zeit der Karolinger“ von Laudage/Hageneier/Leiverkus und „Die Karolinger“ von Rudolf Schieffer.
2. Die Anfänge als Herrscher über das Frankenreich ab 813/14
Als im Jahr 810 mit Pippin und 811 mit Karl zwei Söhne Karls des Großen starben, war, trotz der Vorbehalte gewisser Kreise am Hof und auch seines Vaters, der Weg für die Alleinherrschaft Ludwigs über das gesamte Frankenreich frei. Der Plan Karls des Großen, die divisio regnorum, also das Reich unter seinen drei legitimen
Söhnen aufzuteilen, war somit hinfällig geworden.[4]
Im Jahre 814 befand sich Ludwig der Fromme in einer völlig anderen Situation als Karl der Große bei seinem Regierungsantritt. Die Zeit der großen expansiven Erfolge war vorbei und Ludwigs Hauptaugenmerk musste nun auf der inneren Konsolidierung und inneren Reformgesetzgebung liegen.
Der Kampf gegen Missstände, eine Integrationspolitik im Vielvölkerstaat und eine greifende Thronfolgeordnung waren somit erst einmal die wichtigsten Aufgaben Ludwigs.[5]
Die Kirchenprivilegien wurden, ganz im Sinne des Bischofs Benedikt von Aniane und auch Ludwigs, erneuert und bestätigt.[6] Ludwig schickte zudem Königsboten aus, die Amtsmissbräuche und Übergriffe aufdeckten.[7] Armenfürsorge und Almosenausteilungen gehörten ebenso zu seinem Selbstverständnis als „Vater der Armen“.[8] Im Prozessrecht führte er das Beweisrecht ein und drängte das Gottesurteil zurück. Die Kreuz- und Kaltwasserprobe wurden abgeschafft und der Zeugenbeweis eingeführt.[9] Den Rechtsschutz minderbemittelter Bevölkerungsgruppen trieb Ludwig ebenso weiter voran.[10]
Die ersten Jahre seiner Regierung standen also ganz im Zeichen der Reformen. Ludwig knüpfte an die Reformpolitik seines Vaters an und führte sie weiter. Auch wegen seiner Wohltaten im Volk musste er damals ein hohes Ansehen genossen haben. Nichts ließ in diesen ersten Jahren ab 814 erahnen, welch ungeheuerlichen Prestige- und Autoritätsverlust Ludwig noch würde ertragen müssen.
3. Die Thronfolgeordnung von 817 (Ordinatio imperii)
Im Jahr 817 befand sich das Frankenreich auf dem Höhepunkt seiner Geschichte[11], denn Ludwig der Fromme sah sich, im Gegensatz zu seinem Vater, nicht mehr als rex Francorum sondern als imperator augustus, also als Nachfolger der römischen Kaiser, was einen totalen Herrschaftsanspruch implizierte. Er wollte das Frankenreich nicht mehr unter seine Söhne aufteilen, wie es fränkischer Brauch gewesen wäre, sondern es gänzlich dem ältesten Sohn Lothar hinterlassen.[12]
Dieser Bruch mit der fränkischen Tradition spaltete andererseits jedoch nicht nur von Anfang an die herrschaftstragende Schicht[13], sondern musste zwangsläufig zum Konflikt mit den jüngeren Brüdern Lothars führen, die mit den Unterkönigreichen Aquitanien (Pippin) und Bayern (Ludwig) abgespeist wurden. Ludwig der Fromme stand unter dem Einfluss des Erzbischofs Hildebald von Köln[14], und es entsteht hier schon der Eindruck, dass es Ludwig weniger um fränkische Traditionen, als um die Vereinheitlichung und Eintracht des Volkes unter dem Christentum ging.
4. Beginn der inneren Konflikte im Frankenreich ab 817/18
4.1 Der Aufstand Bernhards von Italien
Die innerdynastischen Spannungen begannen als Ludwigs Neffe Bernhard von Italien, der in der ordinatio unerwähnt blieb, den Aufstand wagte um seine Stellung in Italien zu halten. Bernhard forderte von den Städten in seinem Regierungsbereich die Treue und beharrte somit auf seiner Macht. Es kam deshalb zum Kampf.[15]
Er unterwarf sich jedoch bald und starb an den Folgen einer Blendung. Ludwig
entledigte sich auch gleich seiner Halbbrüder Drogo, Hugo und Theoderich, die er in ein Kloster einwies um weitere eventuelle Auseinandersetzungen zu unterbinden.[16]
Ludwig griff beim Aufstand seines Neffen hart durch. Er bestrafte die Aufrührer und verbannte etwaige Kontrahenten vom Hof. Doch konnte der Karlssohn über die Jahre nicht gleich eisern gegen Widersacher vorgehen und fuhr keinen einheitlichen Kurs. Ludwig begnadigte Verschwörer, demütigte sich durch Kirchenbußen und schwankte, wie bereits erwähnt, zwischen Reichsteilung und Reichseinheit. Letzteres auch bedingt durch die Einflussnahme seiner zweiten Frau Judith und des gemeinsamen Sohnes Karl, worauf noch einzugehen ist. Als sein engster Vertrauter Benedikt von Aniane 821 starb, verlor er seinen wichtigsten Berater.
Die kirchlichen Reformen lahmten seitdem und die Versöhnung mit ehemaligen Gegnern wurde möglich.[17] Hier ist deutlich zu sehen, dass Ludwig durchaus abhängig von seinem Berater war, und ohne Benedikt auf eine Regierung der Schwäche zusteuerte. Die zeigte sich schon bald bei der Kirchenbuße von Attigny, wo Ludwig der Fromme noch lebende Verschwörer des Bernhardaufstandes begnadigte, öffentlich für Bernhards Tod Buße tat und auch seine Halbbrüder wieder an sich band. Sicher waren aufrichtige Reue für den Tod Bernhards und sein christliches Selbstverständnis seine Beweggründe, doch kratzte dieses indirekte Schuldeingeständnis[18] bereits an seiner Autorität. Auch der Eifer und Enthusiasmus bezüglich der Kapitulariengesetzgebung ging zwischen 819 und 829 deutlich zurück.[19] Ein weiterer Beweis seiner Abhängigkeit von außen.
[...]
[1] Thegan Leben Kaiser Ludwigs, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte I, hg. von Reinhold Rau (FSGA 5), Darmstadt 1987 (repr. 1993), c. 20.
[2] Das Leben Kaiser Ludwigs vom sog. Astronomus, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte I, hg. Von Reinhold Rau (FSGA 5), Darmstadt 1987 (repr. 1993).
[3] E. Boshof: Ludwig der Fromme, Darmstadt 1996, S. 4f
[4] Boshof: Ludwig, S. 4f.
[5] R. Schieffer: Die Karolinger, Stuttgart 2006, S. 113.
[6] Thegan: Leben Ludwigs, c.10.
[7] Thegan: Leben Ludwigs, c. 13.
[8] Thegan: Leben Ludwigs, c. 6, Vgl. c. 19.
[9] Boshof: Ludwig, S. 116f.
[10] H. Mordek: Unbekannte Texte zur karolingischen Gesetzgebung. Ludwig der Fromme, Einhard und die Capitula adhuc conferenda, in DA 42, Köln/Wien 1986, S. 464.
[11] Th. Schieffer: Die Krise des karolingischen Imperiums, in: Aus Mittelalter und Neuzeit, Bonn 1957, S.8.
[12] Schieffer: Karolinger, S. 1
[13] J. Laudage u.a.: Die Zeit der Karolinger, Darmstadt 2006, S. 58.
[14] Boshof: Ludwig, S. 129.
[15] J. Jarnut: Kaiser Ludwig der Fromme und König Bernhard von Italien. Der Versuch einer Rehabilitierung, in: Studi Medievali 30, 1989, S. 640.
[16] Astronomus: Ludwig, c. 30; vgl. Boshof: Ludwig, S. 143; dazu: Laudage: Karolinger, S. 60; vgl. Schieffer: Karolinger, S. 118-119.
[17] Schieffer: Karolinger, S. 121; vgl. dazu Boshof: Ludwig, S. 151.
[18] Laudage: Karolinger, S. 61.
[19] G. Schmitz: Zur Kapitulariengesetzgebung Ludwigs des Frommen, in: DA 42, 1986, S. 501.