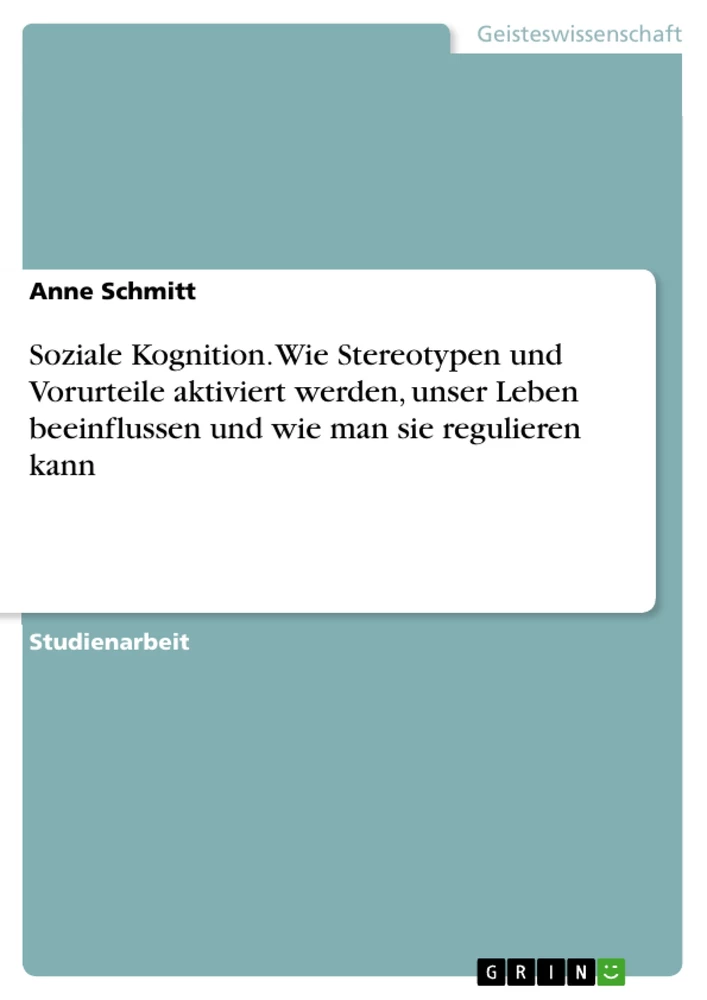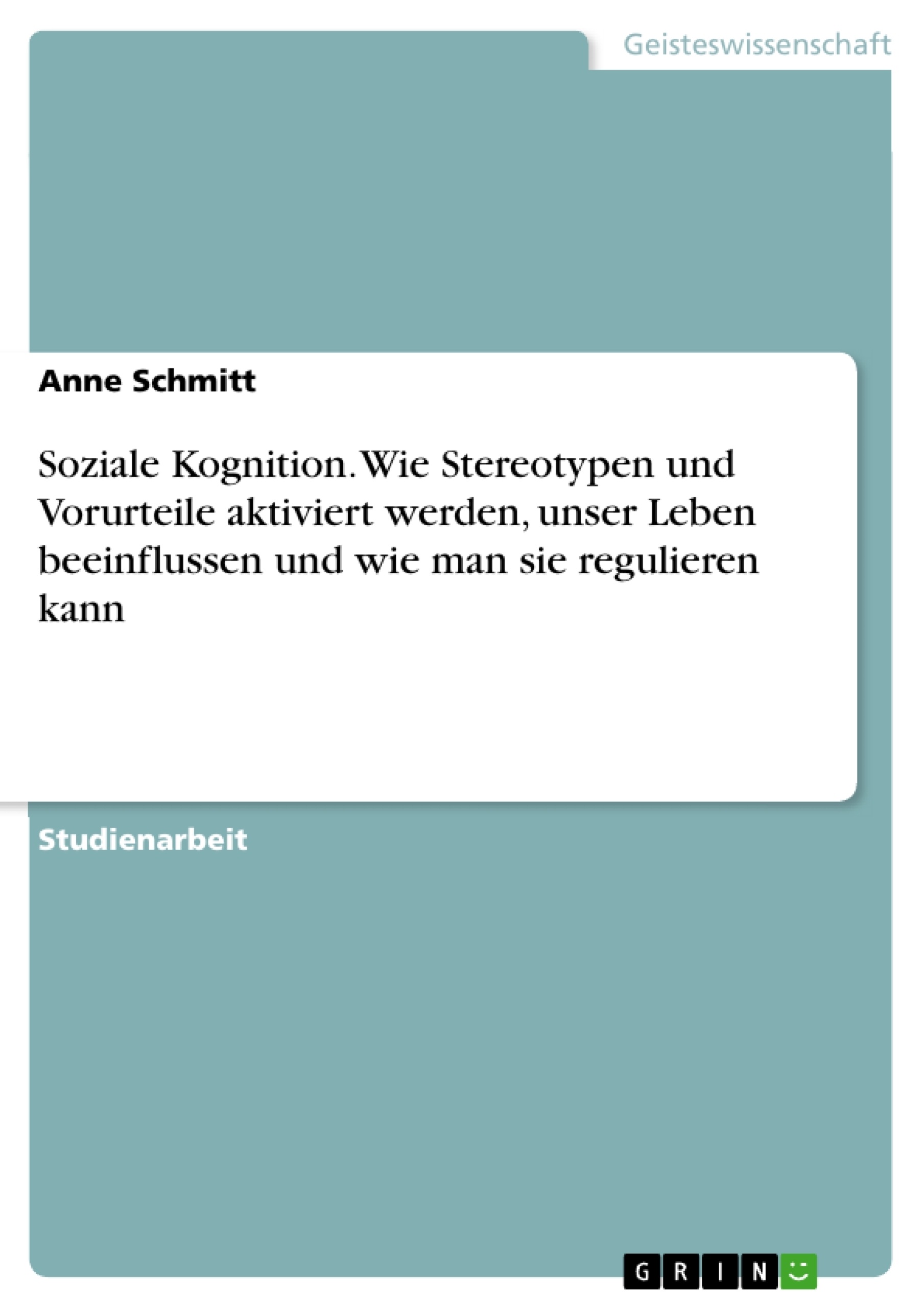Soziale Kognition ist ein umfassendes Thema innerhalb der Sozialpsychologie, das sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie wir über uns selbst und über andere Menschen denken und wie die beteiligten Prozesse unsere Urteile und unser Verhalten in sozialen Kontexten beeinflussen.
Dabei stellen wir uns zum Beispiel folgende Fragen:
„Warum nahm ich an, der Mann an der Kaffeemaschine im Vorstandszimmer sei der Chef der Firma, während er doch tatsächlich der Sekretär ist?“ oder „Warum nahm ich an, dass Dr. Alex James männlich und weiß ist?“
Diese und viele weitere Fragen sind Bestandteil der sozialen Kognition, und somit auch das Phänomen, voreilig Schlüsse zu ziehen bzw. sich ein Bild von einem Menschen zu machen, den man gar nicht kennt.
Ziel dieser Arbeit ist es zu erläutern, was man unter soziale Kognition versteht, wie Stereotypen und Vorurteile aktiviert werden, welche Einflüsse diese auf uns haben und wie man es schafft, die Aktivierung von Vorurteilen und Stereotypen zu verhindern bzw. diese abzuschwächen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... III
Tabellenverzeichnis ... IV
Einleitung ... 1
1 Begriffsbestimmung ... 2
1.1 Was versteht man unter Kategorisierung? ... 2
1.2 Stereotypen ... 2
1.3 Vorurteile ... 2
1.4 Diskriminierung ... 3
1.5 automatischer vs. Kontrollierter Prozess ... 3
1.6 Heuristiken ... 4
1.6.1 Repräsentativitätsheuristik ... 4
1.6.2 Verfügbarkeitsheuristik ... 4
1.6.3 Anker- & Anpassungsheuristik ... 5
1.7 Schemata und Priming ... 5
2 Messung von Stereotypen und Vorurteilen ... 6
2.1 Bogus Pipeline ... 6
2.2 Verdeckte Beobachtung ... 6
2.3 Erfassung psychologischer Reaktionen ... 6
2.4 Messung implizierter Assoziationen ... 6
3 Aktivierung von Stereotypen ... 7
3.1 Automatische Aktivierung vs. Bewusste Regulierung von Stereotypen ... 7
3.2 Aktivierung von Schemata ... 8
4 Schema-Aktivierung und Verhalten ... 9
5 Kontrolle gegenüber Vorurteilen und Stereotypen ... 10
5.1 Automatische Aktivierung des Stereotyps verhindern ... 10
5.2 Die Folgen der Unterdrückung stereotyper Gedankeninhalte ... 10
5.2.1 Der Stroop-Effekt ... 10
5.2.2 Der Bumerang- oder auch Rebound-Effekt ... 11
5.3 Die Kontakthypothese ... 11
5.4 Was tun, wenn Stereotypen bereits aktiviert sind? ... 12
5.4.1 Das Kontinuummodell der Eindrucksbildung ... 12
5.4.2 Dissoziationsmodell der Stereotypisierung ... 13
5.4.3 Moderatorvariablen beim Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Verhalten ... 13
6 Vorurteile in Mensch und Gesellschaft ... 14
7 Fazit ... 16
8 Anhang ... 17
8.1 Automatischer vs. Kontrollierter Prozess ... 17
8.2 Stirnrunzeln als Indikator für bestehende Vorurteile ... 18
8.3 Ablauf des implizierten Assoziationstests ... 19
8.4 Schema-Aktivierung und Verhalten ... 20
8.5 Ablauf beim Bumerang-Effekt ... 21
8.6 Was tun, wenn Stereotypen bereits aktiviert sind? ... 22
8.7 Der Selbstfokus ... 22
8.8 Autoritäre Persönlichkeiten ... 23
8.9 Gesellschaftliche Trends ... 24
8.10 Die sich selbst erfüllende Prophezeiung ... 25
8.11 Stereotype Threat – Bedrohung durch Stereotypen ... 26
9. Literaturverzeichnis ... 27
10. Quellenverzeichnis ... 28