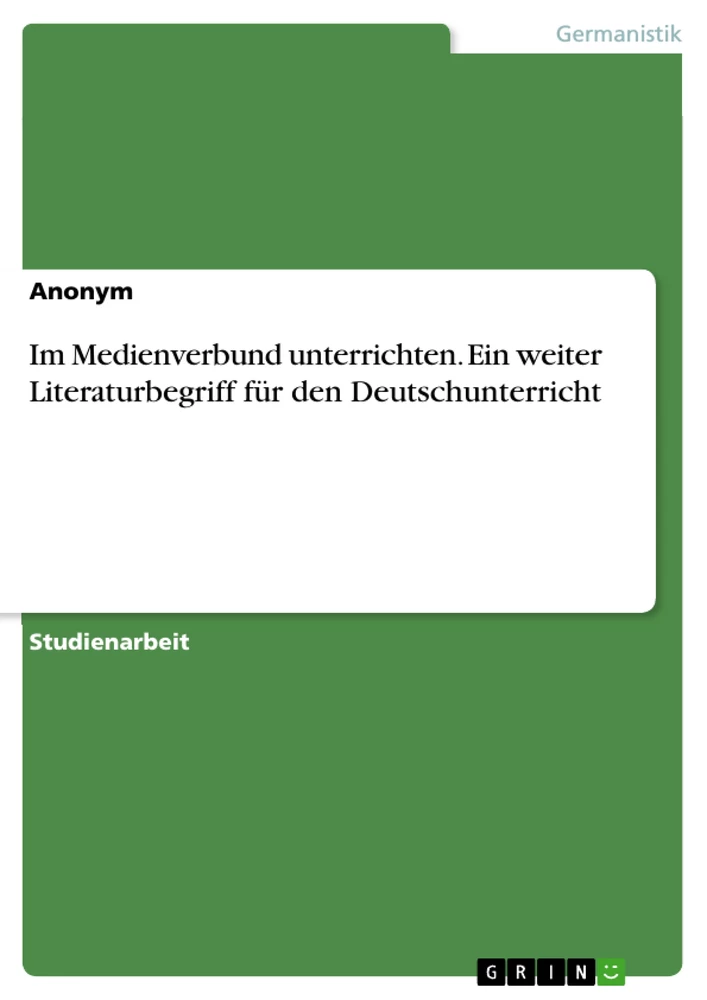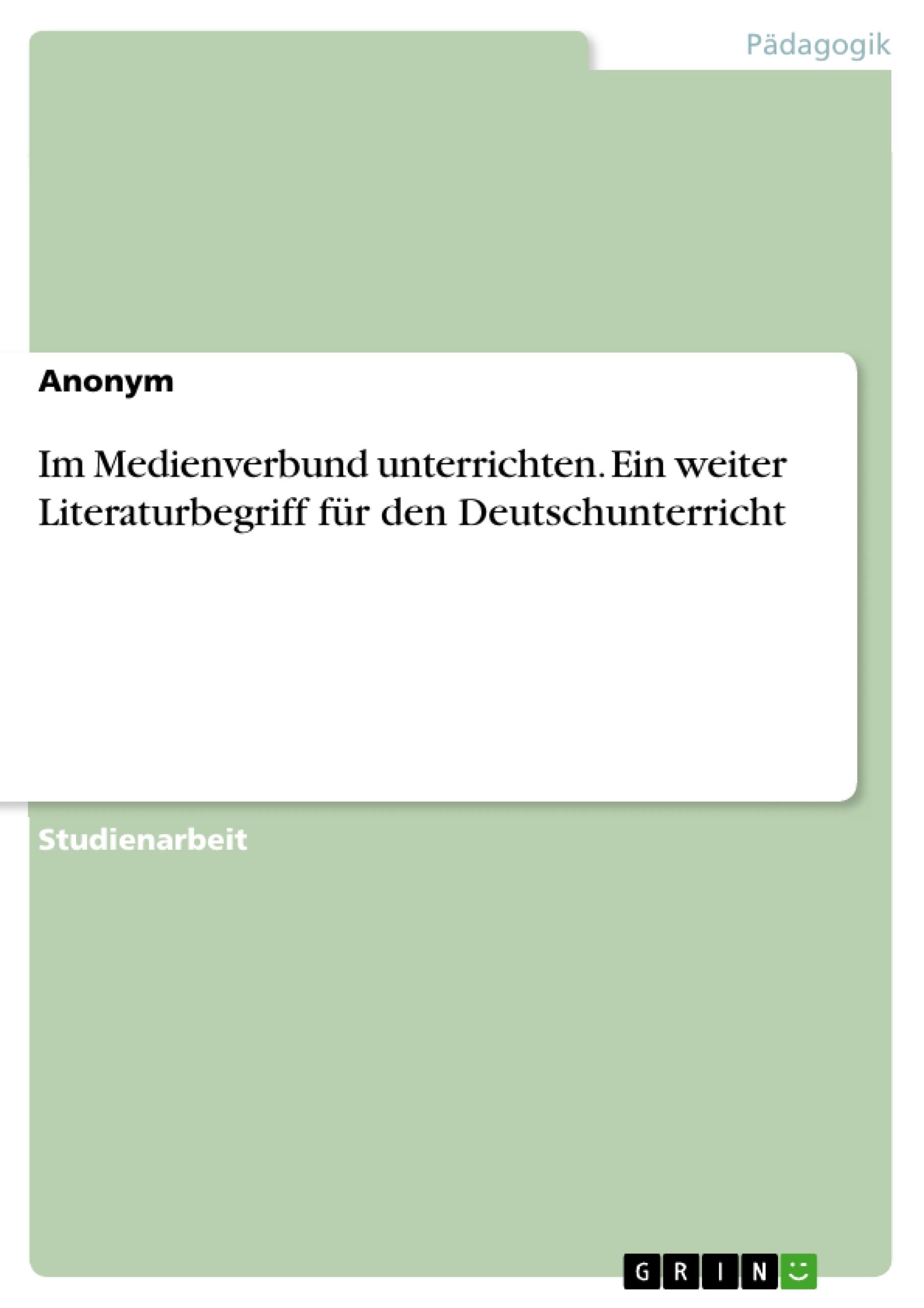Gegenstand dieser Arbeit wird es sein, die Notwendigkeit nach Einbeziehung von Literatur jeder Medialität in den Deutschunterricht zu begründen. Dass sich hierfür die Arbeit im Medienverbund anbietet, soll im Verlauf der Argumentation aufgezeigt werden.
Zu Beginn werden die Begriffe „Medien“ und „Medienverbund“ spezifiziert. Punkt Zwei gliedert sich in vier Unterpunkten, die entscheidende Tatsachenbestände aufzeigen und die Relevanz eines „weiten Literaturbegriffs“ untermauern.
Wie letztendlich ein von einem weiten Literaturverständnis getragener Deutschunterricht im Medienverbund aussehen könnte, soll das abschließend analysierte Praxisbeispiel verdeutlichen.
Inhalt
Einleitung
1 Begriffsbestimmung „Medien“ und „Medienverbund“
2 Warum im Medienverbund unterrichten?
2.1 Begründung von den Gegenständen her
2.2 Begründung von der Lebenswirklichkeit der Lernenden her
2.3 Begründung von erwünschten (Neben-) Effekten her
2.4 Begründung mit Blick auf die Förderung literarischer Kompetenz
3 Analyse einer medienintegrativen Unterrichtsreihe (5./6. Klasse) - Barbara Schubert-Felmy/ Kristina Schubert
Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Es geht dabei nicht an, den Zusatz ,... und Medien´ zwar im Lernbereichstitel mitzuführen, aber inhaltlich doch ausschließlich bzw. vorwiegend das Buch und allenfalls andere Printmedien abzuhandeln […]. (Abraham/ Kepser 2009, S. 142)
Das Zitat beklagt ein bis heute noch mehrheitlich in den Klassenzimmern verbreitetes Problem. Die Einbeziehung elektronischer bzw. digitaler Medien in den Unterricht ist unbefriedigend. Lehrkräfte greifen bei der Vermittlung von Lerninhalten nur selten auf Filme, Hörkassetten, CD-ROMs etc. zurück. Falls doch, wird ihr Einsatz didaktisch unterschätzt und oftmals nicht kompetenzorientiert ausgerichtet. So wird im schlimmsten Fall eine Literaturverfilmung auf den Abschluss einer Unterrichtsreihe begrenzt und von Schülerinnen und Schülern lediglich als unterhaltend wahrgenommen.
Bartnitzky (2008, S. 109) sieht die printmediale Bevorzugung durch zeitliche Engpässe begründet. Das Primat der Lesekompetenzförderung ließe zu wenig Freiraum um auch nicht schriftliche Texte zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. Tatsächlich liegt der bildungspolitische Fokus nach den Ergebnissen der PISA-Studie 2000 vorrangig auf der Vermittlung von Lesekompetenz, statt auf Bemühungen eines differenzierteren Eingangs von Medien in die Bildungsstandards (vgl. Wildemann/ Vach 2013, S. 97). Diese würden ausschließlich „in enger Verknüpfung mit dem Leseunterricht“ (Abraham 2013, S. 203) behandelt und seien lediglich „additiv“ (Wildemann/ Vach 2013, S. 97) dem Kompetenzbereich „Lesen - mit Medien und Texten umgehen“ (KC, 2006, S. 19) hinzugefügt. „Die Einsicht, dass auch Schreiben und Medien oder Sprachreflexion und Medien zusammengehören, wird zum Opfer solcher Systematiken“, so Abraham (2013, S. 203; vgl. auch Bartnitzky 2008, S. 64-105).
Ein Problembewusstsein innerhalb der Deutschdidaktik bezüglich den aktuellen Medialisierungstendenzen besteht jedoch. Nach Absprache der Bund-Länder-Kommission 1995 wird ein eigenständiges Fach für Medien zwar ausgeschlossen, jedoch eine stärkere Einbindung, besonders von elektronischen Medien, in den Unterricht für alle Fächer vorgesehen (vgl. Abraham, 2013, S. 202). In der Deutschdidaktik haben sich seit Mitte der neunziger Jahre Ansätze wie das medienintegrative Unterrichtskonzept von Wermke, das computerunterstützte von Jonas und Rose, das intermediale von Bönnighausen und Rösch sowie das symmediale Unterrichtskonzept von Frederking verbreitet (vgl. Frederking/ Krommer/ Maiwald 2012, S. 92-97). Auch das Potenzial von Medienverbünden als Gegenstand des Unterrichts gerät unter Deutschdidaktikern wieder stärker in den Fokus (vgl. Wildemann/ Vach, 2013, S. 98). Was genau Medienverbünde für den Deutschunterricht so interessant macht, soll im Verlauf dieser Arbeit geklärt werden.
Gegenstand dieser Arbeit wird es sein, die Notwendigkeit nach Einbeziehung von Literatur jeder Medialität in den Deutschunterricht, wie es das Anfangszitat von Abraham und Kepser fordert, zu begründen. Dass sich hierfür die Arbeit im Medienverbund anbietet, soll im Verlauf der Argumentation aufgezeigt werden. Zu Beginn werden die Begriffe „Medien“ und „Medienverbund“ spezifiziert. Punkt Zwei gliedert sich in vier Unterpunkten, die entscheidende Tatsachenbestände aufzeigen und die Relevanz eines „weiten Literaturbegriffs“ untermauern. Wie letztendlich ein von einem weiten Literaturverständnis getragener Deutschunterricht im Medienverbund aussehen könnte, soll das abschließend analysierte Praxisbeispiel verdeutlichen.
2 Begriffsbestimmung „Medien“ und „Medienverbund“
Zur Bestimmung des Begriffs „Medien“ wird sich hier auf die verbreitete Medienkonzeption von Siegfried J. Schmidt bezogen:
- Medien lassen sich im Hinblick auf Zeichensysteme wie Sprache, Schrift, Bilder und Töne betrachten,
- durch welche die Kommunikationsinhalte, also Medienangebote bzw. Texte, sinnhaft gestaltet sind
- und die mithilfe von Geräten, Objekten oder Technologien gespeichert, vermittelt
- und mono- bzw. multimodal verarbeite werden können.
- Die gesellschaftliche Durchsetzung der Medien ist gebunden an Organisationen und
Institutionen, die sich auf die Erstellung und Verbreitung bzw. auf die kommerziell gewinnbringende, globalisierte Vermarktung konzentrieren. Die Entwicklung der Medien ist somit immer auch von ökonomischen, rechtlichen und politischen Faktoren abhängig, die wiederum auf die Medieninhalte zurückwirken. (Vgl. Schmidt 1996, S. 83; 1999, S. 122; zit. n. Wildemann/ Vach 2013, S. 98f.)
Eine komprimierte, aber auch an Schmidt anlehnende Mediendefinition findet sich bei Maiwald (2010). Er unterscheidet Medien auf vier Ebenen:
1. Kommunikationsinstrumente (Sprache, Bilder)
2. technische Mittel bzw. Geräte zur Erzeugung, Übertragung, Speicherung von Zeichen
3. mit diesen Mitteln erzeugte ,Texte` (Medienangebote)
4. sozial-systematische Ordnungen (Organisationen, Institutionen) (Maiwald 2010, S. 136f.)
Zur Verdeutlichung dieser Typologie bezieht sich Maiwald auf das Beispiel „Krabat“. Hier unterscheidet er auf der Ebene der Medienangebote den Film, das Buch und das Hörspiel: Diese unterschiedlichen Medienangebote präsentierten ein und die selbe Geschichte mit Hilfe ihrer jeweils spezifischen Kommunikationsinstrumente. Das Buch nutze Schrift und Illustrationen. Hörspiel und Film griffen auf Geräusche, Töne und den Erzählinstanzen, die sprechen, zurück. Letzteres ziehe bewegte Bilder hinzu. Zur Speicherung, Erzeugung und Übertragung dieser Kommunikationsinstrumente erfordere der Film zum Beispiel eine Filmrolle und eine Leinwand wie etwa im Kino. Das Hörspiel brauche zur Übertragung der Geschichte, die zum Beispiel auf einer Kassette, einer CD o.ä. gespeichert ist, ein Abspielgerät wie den „CD-Player“. Zum Lesen eines Romans, so Maiwald, benötige es zum Beispiel ein Buch. Die vierte und letzte Ebene mache deutlich, wer hinter den Ausformungen der verschiedenen Medienangebote stecke. Bei „Krabat“ seien dies Organisationen wie der Fernsehsender Pro7 und die Deutsche Post, die Produktionsfirma JUMBO und Institutionen wie die Stiftung Lesen (vgl. ebd., S. 137).
Auch der Begriff „Medienverbund“ lässt sich durch diese vier Ebenen spezifizieren: Ein Medienverbund setzt erstens voraus, dass der fiktionale Stoff gleichzeitig in unterschiedlichen medialen Ausformungen präsent ist. Bei „Krabat“ als Buch, Film und Hörspiel. Diese werden oft durch sogenannte „Sekundärmedien“ begleitet, wie dem Plakat, der DVD mit Bonusmaterial oder dem Klingelton mit zum Beispiel entsprechendem Soundtrack zum Film (vgl. ebd., S. 139). Zweitens gehört zu einem ausgebildeten Medienverbund ein umfangreiches Angebot an Fanartikeln, die durch den Verkauf von Nebenrechten geschützt sind. Sogenannte Merchandising-Produkte können sein: Kleidung, Sammelstickers- und Figuren, unterschiedlichste Spielzeuge, Schlüsselanhänger usw. (vgl. ebd.). Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Medienverbünden sind Fanseiten und -foren im Internet. Hier können die Besucher interagieren, sich kennenlernen und Meinungen artikulieren. Auch werden verschiedene Spiele, wie Ratequizze o.ä., zur Thematik des jeweiligen fiktionalen Stoffes angeboten. Hervorzuheben ist, dass es sich bei Medienverbünden aber nicht um ein banales Nebeneinander von Medien des selben Inhalts handelt. Vielmehr sind sie, auf der sozial-systematischen Ebene, eine von Organisationen und Instituten planvoll erzeugte und kommerziell ausgerichtete „fiktional-ästhetische Erlebnis- und Konsumzone“ (Maiwald 2007, S. 38; 2010, S. 140).
3 Warum im Medienverbund unterrichten?
Die Frage nach Integration von Medienverbünden in den Unterricht hängt mit einer seit Mitte der neunziger Jahre geführten Debatte zusammen, warum Medien Bestandteil der Bildung sein sollten (vgl. Maiwald 2007, S. 38). Medienskeptiker argumentierten mit einem möglichen negativen Einfluss von Medien bzw. Medieninhalten auf die kindliche Wahrnehmung und Identitätsbildung. Fernsehen und Werbung seien verantwortlich für ein frühzeitiges „Verschwinden der Kindheit“ (Postman 1982), da die Inhalte nicht kindgerecht und für Erwachsene bestimmt seien. Diese würden „krank machen “ und „kriminalisierten“ (Glogauer 1991; 1999) Heranwachsende (vgl. Frederking/ Krommer/ Maiwald 2012, S. 68).
Hier ist nicht der Platz um den einen oder anderen Vorwurf zu untersuchen. Vielmehr soll darauf hingewiesen werden, dass keine dieser Position die Realität anerkennt, dass Medien und Medienverbünde fester Bestandteil unserer Kultur sind. Bildungspolitische Tendenzen nehmen, durch das Primat der Lesekompetenzförderung zwar verlangsamt, Medien zumindest wieder stärker in den Blick. Dabei geht es weniger darum, „Gefahren abzuwenden als Potenziale zu nutzen“ (Maiwald 2007, S. 46).
3.1 Begründung von den Gegenständen her
Wie bereits Punkt 1 aufgezeigt hat, ist ein fiktionaler Stoff nicht an das Medium Buch gebunden. Deutlich wird dies vor allem durch die Tatsache, dass der Buchdruck erst im 15. Jahrhundert entwickelt und lange Zeit davor bereits Geschichten mündlich tradiert wurden (vgl., Josting/ Maiwald 2007, S. 7). Mittlerweile lässt sich zweifellos behaupten, dass das Buch nicht mehr das erstrezipierte Trägermedium einer Geschichte sein muss. Die KIM- Studie 2010 macht deutlich: 50% der befragten Kinder geben als Medium, auf das sie am wenigsten verzichten können, den Fernseher an. Schlappe 5% hingegen das Lesen eines Buches. Hat sich somit die „Verdrängunghypothese“ bestätigt, die in der Mediensozialisationsforschung und in der Medienpädagogik lange Zeit als übertriebene Skepsis verworfen wurde? Überlagern bzw. verdrängen die neuen Medien das Buch (vgl. Frederking/ Krommer/ Maiwald 2012, S. 83)? Die beliebtesten Medien der Gegenwart sind Film und Fernsehen, doch verschwinden Bücher dadurch nicht von der Weihnachtswunschliste. Eher erfolge eine „Bedeutungs- und Funktionsverschiebung“ für Buch und Lesen. Wenn Fernsehen und Film die neuen Leitmedien sind, d.h. die Medien, nach denen Kinder ihre „Rezeptionserwartungen, -gewohnheiten und -präferenzen“ (ebd., S. 65f.) ausrichten, wirkt die Lektüre eines Gesellschaftsromans im Unterricht ermüdend. Durch Fernsehen, Film, DVD, Computer, CD-ROM usw. haben sich Präsentations- und Rezeptionsform von Sprache und Literatur verändert. Somit ist eine reine Buchorientierung im Unterricht unzureichend (vgl. ebd., 76f; vgl. Maiwald 2010, S. 141).
[...]