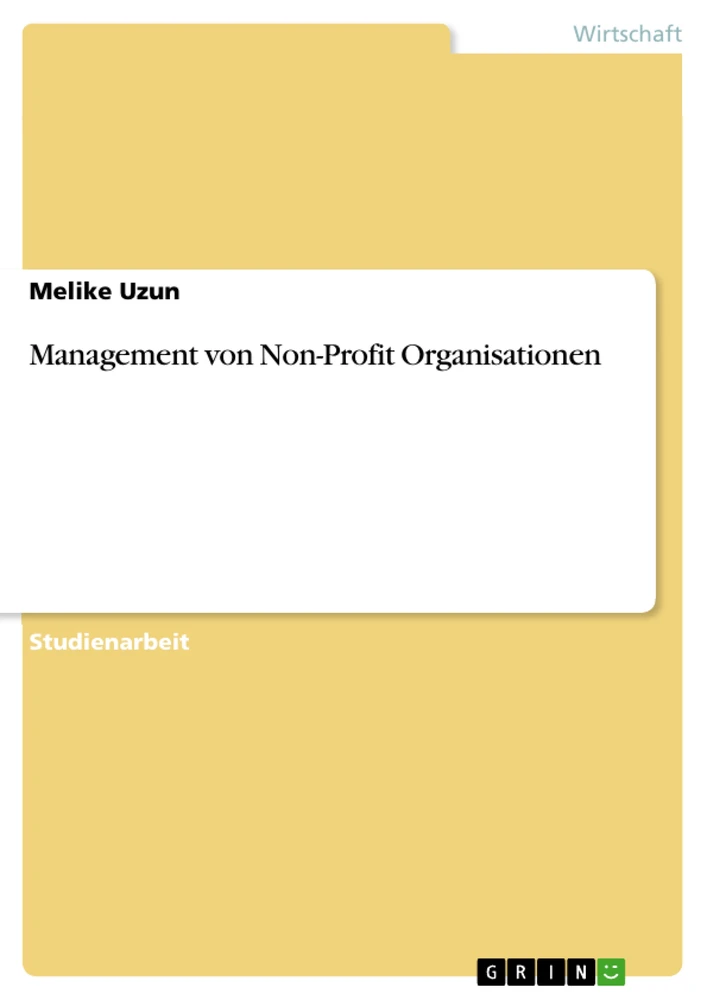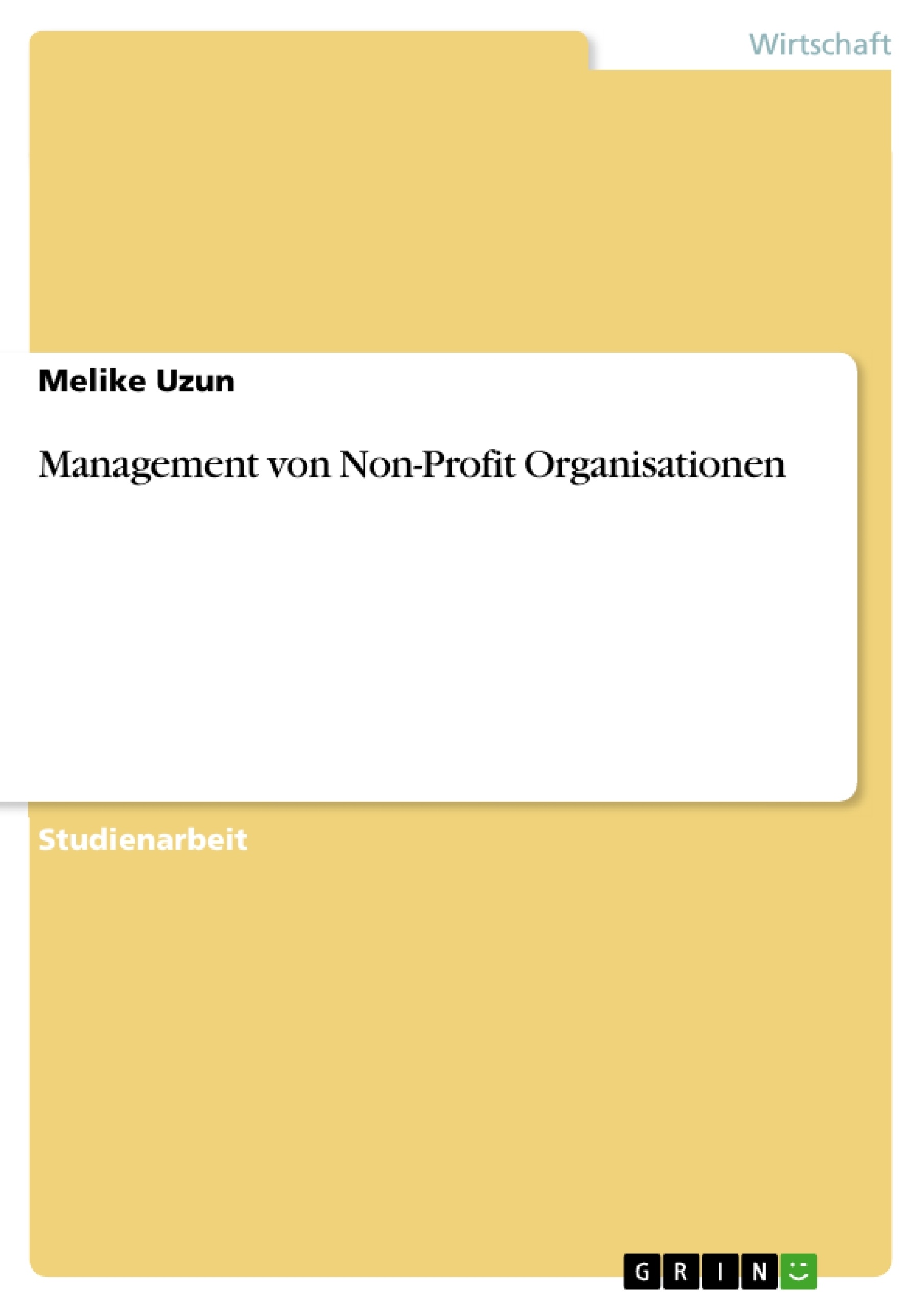Ziel dieser Hausarbeit ist es, dem Leser das Thema Management von Non-Profit-Organisationen verständlich darzulegen.
Non-Profit-Organisationen (NPOs) leisten in Deutschland und international im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben moderner Gesellschaften wichtige Beiträge und haben einen hohen Stellenwert. Sie wachsen immer weiter und bewahren dabei die Verbandsstruktur von ehren- und hauptamtlichem Management. Um sozial- oder verbandspolitische Entscheidungen zu treffen, brauchen die NPO betriebswirtschaftliche Instrumente. Diese betriebswirtschaftlichen Instrumente müssen mit Hilfe des operativen Managements die Ziele und Strategien der Organisationen realisieren. Darüber hinaus sind die NPO mit einer Vielzahl von weiteren Problemen konfrontiert. Da die staatliche Finanzierung von NPOs immer komplizierter wird, werden in der Öffentlichkeit die Trends der Professionalisierung und die Verwendung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten von grundlegender Bedeutung. So wird mit der Zunahme der Professionalisierung in NPOs der Wunsch der Spendenden nach Transparenz, effektiver Verwendung der Mittel, Verantwortung und Rechenschaftslegung berücksichtigt.
Kapitel 1 und 2 bilden die Grundlagen und zeigen die Hauptgruppen, die Rechtsform und die wirtschaftliche Bedeutung des Non-Profit-Sektors in Deutschland auf. Kapitel 3 gibt Einblicke in die theoretischen Erklärungsansätze zur Entstehung von Non-Profit-Organisationen. Kapitel 4 stellt das Personalmanagement in NPOs dar und gibt einen Überblick über die Personalstrukturen und Motive für die Freiwilligenarbeit im Non-Profit-Bereich. In Kapitel 5 werden das Fundraising Management mit den Erklärungsansätzen des Spendenverhaltens, mit Daten und Fakten zum Spendenverhalten in Deutschland und die Fundraising-Instrumente beschrieben. Während in Kapitel 6 die Finanzierungsquellen von NPOs veranschaulicht werden, werden in Kapitel 7 die Trends der Professionalisierung von NPOs präsentiert. Im Anschluss wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen des Non-Profit-Managements
2.1 Bedeutung von NPOs
2.2 Definition des Non-Profit-Begriffes
2.3 Hauptgruppen und Rechtsform
2.3.1 Hauptgruppen
2.3.2 Rechtsform
2.4 Wirtschaftliche Bedeutung des Non-Profit-Sektors
3 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung von Non-Profit- Organisationen
4 Personalmanagement in NPOs
4.1 Personalstrukturen im Non-Profit-Bereich
4.2 Motive für die Freiwilligenarbeit
5 Fundraising Management
5.1 Begriffliche Grundlagen des Fundraising
5.2 Erklärungsansätze des Spendenverhaltens
5.2.1 Modell zur Erklärung des Spendenverhaltens
5.3 Daten/Fakten zum Spendenverhalten & Spendenmarkt in Deutschland 2010
5.4 Fundraising-Instrumente
6 Finanzierungsquellen von NPOs
7 Trends der Professionalisierung in NPOs
8 Zusammenfassung/Fazit/Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Drei-Sektoren-Modell
Abbildung 2: International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO)
Abbildung 3: Wirtschaftliche Bedeutung des Non-Profit-Sektors in Deutschland im Jahr
Abbildung 4: Theoretische Erklärungsansätze für das Vorhandensein von NPOs (Existenztheorien)
Abbildung 5: Personalstruktur im NPO-Sektor
Abbildung 6: Motive für die Freiwilligenarbeit
Abbildung 7: Spenderquote der Gesamtbevölkerung in Deutschland 2009
Abbildung 8: Modell zur Erklärung des Spendenverhaltens
Abbildung 9: Spendenzwecke
Abbildung 10: Demografisches Profil im Überblick: Neuspender vs. treue Spender im Jahr
Abbildung 11: Anzahl der Spenden nach Uhrzeit
Abbildung 12: Spendentage in Deutschland 2012 und
Abbildung 13: Fundraising-Instrumente im Überblick
Abbildung 14: Finanzierungsquellen von NPOs
Abbildung 15: Beispiel Deutscher Caritasverband 2009
1 Einleitung
Non-Profit-Organisationen (NPOs) leisten in Deutschland und international im wirtschaft- lichen, sozialen und kulturellen Leben moderner Gesellschaften wichtige Beiträge und haben einen hohen Stellenwert. Sie wachsen immer weiter und bewahren dabei die Ver- bandsstruktur von ehren- und hauptamtlichem Management. Um sozial- oder verbands- politische Entscheidungen zu treffen, brauchen die NPO betriebswirtschaftliche Instru- mente. Diese betriebswirtschaftlichen Instrumente müssen mit Hilfe des operativen Ma- nagements die Ziele und Strategien der Organisationen realisieren. Darüber hinaus sind die NPO mit einer Vielzahl von weiteren Problemen konfrontiert. Da die staatliche Finan- zierung von NPO immer komplizierter wird, werden in der Öffentlichkeit die Trends der Professionalisierung und die Verwendung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten von grundlegender Bedeutung. So wird mit der Zunahme der Professionalisierung in NPO der Wunsch der Spendenden nach Transparenz, effektiver Verwendung der Mittel, Ver- antwortung und Rechenschaftslegung berücksichtigt. Ziel dieser Hausarbeit ist es, dem Leser das Thema Management von Non-Profit-Organisationen verständlich darzulegen. Kapitel 1 und 2 bilden die Grundlagen und zeigen die Hauptgruppen, die Rechtsform und die wirtschaftliche Bedeutung des Non-Pofit-Sektors in Deutschland auf. Kapitel 3 gibt Einblicke in die theoretischen Erklärungsansätze zur Entstehung von Non-Profit-Or- ganisationen. Kapitel 4 stellt das Personalmanagement in NPOs dar und gibt einen Über- blick über die Personalstrukturen und Motive für die Freiwilligenarbeit im Non-Profit-Be- reich. In Kapitel 5 werden das Fundraising Management mit den Erklärungsansätzen des Spendenverhaltens, mit Daten und Fakten zum Spendenverhalten in Deutschland und die Fundraising-Instrumente beschrieben. Während in Kapitel 6 die Finanzierungs- quellen von NPOs veranschaulicht werden, werden in Kapitel 7 die Trends der Professi- onalisierung von NPOs präsentiert. Im Anschluss wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen.
2 Grundlagen des Non-Profit-Managements
2.1 Bedeutung von NPOs
Non-Profit-Organisationen (NPOs) haben in der Gesellschaft einen wichtigen Stellen- wert und werden als erforderlich und sinnvoll betrachtet. NPOs verfolgen nicht das Ziel der Gewinngenerierung und werden als Teil des „Dritten Sektors“ betrachtet. Im Drei- Sektoren-Modell steht der „Dritte Sektor“ neben den beiden Bereichen „Staat“ und „Markt“ (vgl. Abbildung 1). Oft wird der Begriff „NPO-Sektor“ synonym verwendet. Bei dem hier vorliegenden Drei-Sektoren-Modell handelt es sich nicht um den Dritten Sektor aus der Volkswirtschaftslehre mit der Unterteilung in Industrie-, Agrar- und Dienstleis- tungssektor. Vielmehr sind hier im Kontext der NPOs private, also nicht staatliche Orga- nisationen darunter zu verstehen. Zudem verdeutlicht die Abbildung 1 die Unterschei- dung der drei Sektoren. Wie diese Darstellung zeigt, sind die drei Sektoren „Öffentlicher Sektor“, „Staat“ und „Dritter Sektor“ keineswegs überschneidungsfrei. Ganz im Gegen- teil, in einzelnen Bereichen wie beispielsweise im Krankenhausbereich oder auch im Sozialbereich existieren viele Überschneidungsflächen. So ist es oftmals nicht möglich, eine Organisation eindeutig einem Sektor zuzuordnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Das Drei-Sektoren-Modell
Quelle: Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6
2.2 Definition des Non-Profit-Begriffes
International gibt es zahlreiche Definitionen für NPOs, auch eine Vielzahl an Synonymen wie „Freiwilligenarbeit“, „zivilgesellschaftliche Organisation“ oder „Nongovernmental Organisation“. Bislang existiert keine einheitliche Non-Profit-Terminologie, über die Begriffsinhalte besteht ebenfalls keine Einigkeit.
Bernd Helmig und Silke Boenigk (2012) definieren NPOs folgendermaßen:
„Unter Nonprofit-Organisationen (NPO) werden alle diejenigen Organisationen verstanden, die weder erwerbswirtschaftliche Firmen noch öffentliche Behörden der unmittelbaren Staats- und Kommunalverwaltung sind.“1
Das Management der NPOs wird von Ehrenamtlichen strategisch geleitet und die Arbeit durch freiwillige Engagierte unterstützt. Die Finanzierung der Leistungen der NPOs er- folgt über Beiträge, Spenden oder Gebühren der Mitglieder in der Organisation. Eine weitere Definition, die international anerkannt ist, ist die im Rahmen des „John Hopkins Comparative Sectore Projektes“ entwickelte Definition. Im Rahmen dieses Projektes wurden im Jahr 1990 verschiedene Industrie- und Entwicklungsländer im Kontext der NPO in ihren ökonomischen, historischen, gesellschaftlichen und politischen Dimensio- nen analysiert.2
Nach dem John Hopkins Projekt werden NPOs folgendermaßen definiert:
„Nonprofit-Organisationen sind:
- formell strukturiert
- organisatorisch unabhängig vom Staat
- nicht gewinnorientiert
- eigenständig verwaltet
- keine Zwangsverbände
- zu einem gewissen Grad von freiwilligen Leistungen getragen.“3
2.3 Hauptgruppen und Rechtsform
2.3.1 Hauptgruppen
Die „International Classification of Nonprofit Organizations“ unterscheidet insgesamt zwölf sogenannte Hauptgruppen bzw. Brancheneinteilungen von NPOs, die im Jahr 1992 entwickelt wurden (siehe Abbildung 2). Die Hauptgruppen sind in weitere Unter- gruppen gegliedert. Es existieren Hauptgruppen wie Kultur und Erholung, Bildungs- und Forschungswesen, Gesundheitswesen, Soziale Dienste sowie Umwelt- und Natur- schutz. Des Weiteren gibt es Hauptgruppen wie beispielsweise Entwicklung, Wohnungs- wesen und Beschäftigung, Vertreter von Bürger- und Verbraucherinteressen, Religionen und weitere.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO) Quelle: Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 23
2.3.2 Rechtsform
80 % der NPOs sind in der Rechtsform des Vereins organisiert.4 Weitere typische Rechtsformen von NPOs sind gemeinnützige GmbH (gGmbH), gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) und die Stiftung. Auch die Genossenschaft kann für Non-Profit-Orga- nisationen als relevante Rechtsform genannt werden. Die Zugehörigkeit der Genossenschaft zu NPOs wird stark diskutiert, da Genossenschaften in Deutschland erwerbswirtschaftliche Ziele verfolgen. Somit verletzen sie die Gewinnausschüttungsrestriktionen, die als Kriterium für die Begriffsdefinition genannt werden.
2.4 Wirtschaftliche Bedeutung des Non-Profit-Sektors
Der Non-Profit-Sektor befindet sich in einem kontinuierlichen Wachstum in Deutschland. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Deutschland zeigte 2007, dass die Brutto- wertschöpfung der Organisationen im Non-Profit-Sektor 89,17 Mrd. € beträgt (Vgl. Abb.3).5 Der prozentuale Anteil der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland lag bei 4,1 %. Auf den Bereich „Gesundheits- und Sozialwesen“ entfallen bei 57,5 % insge- samt 51,27 Mrd. €. Auf die Bereiche „Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige Vereinigungen“ entfallen 15,43 Mrd. €, auf den Bereich „Erziehung und Unterricht“ 12,93 Mrd. €. Zudem entfallen 3,61 Mrd. € auf den Bereich „Kultur, Sport und Unterhaltung“ und auf den Bereich „Forschung und Entwicklung“ 2,08 Mrd. €.6 In Deutschland gibt es zahlreiche Vereine. Deutschland zählte im Jahr 2007 insgesamt 554.000 Vereine, 17.000 gemeinnützige Stiftungen, 7.900 Genossenschaften, 64 Gewerkschaften und 30 Einzelgewerkschaften.7 Interessant ist zudem, dass hohe Mitgliederzahlen zu beobach- ten sind. Allein der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte im Jahr 2007 ca. 6,4 Mio. Mitglieder.8 Neben dem DGB existieren weitere wichtige Wirtschafts- und Berufsver- bände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Bundesvereini- gung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA). Darüber hinaus sind bei fünf deutschen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege über eine Million Menschen in über 100.000 Ein- richtungen engagiert.9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Wirtschaftliche Bedeutung des Non-Profit-Sektors in Deutschland im Jahr 2007
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 7
3 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung von Non-Profit-Organisationen
In den 1970er und 1980er wurden in verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedliche Theorien zu dem Zweck der Erklärung des Vorhandenseins von NPOs entwickelt. Die Existenztheorien werden hier nach der Provenienz unterschieden. Es existieren soziologische, ökonomische und politologische Theorien, die allesamt Erklärungsansätze anbieten, warum es überhaupt NPOs gibt (siehe Abbildung 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Theoretische Erklärungsansätze für das Vorhandensein von NPOs (Exis- tenztheorien)
Quelle: Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 44
Im Bereich der Soziologie gibt es unterschiedliche Auffassungen, die sich in makro- und mikrosoziologische Theorien unterteilen lassen. Die politologischen Theorien unterteilen sich wiederum in drei dominante Theorien. Dominant sind hier die drei Theorien „Interdependenztheorie“, „Institutionelle Theorie“ und der „Funktionale Dilettantismus“. Im Rahmen dieser Hausarbeit wird auf die soziologischen und politologischen Theorien nicht eingegangen. Dominant und am wichtigsten sind die ökonomischen Theorien, die sogenannten volkswirtschaftlichen Theorien. Im Folgenden werden die in Abbildung 4 aufgeführten ökonomischen Theorien zur Erklärung des Vorhandenseins von NPOs dargelegt. Hier werden folgende drei Theorien unterschieden:
[...]
1 Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 11
2 Vgl. Zimmer, A./Eckhard, P. (2001), S. 17, Die zunehmende Bedeutung des Dritten Sektors, Ergebnisse des international vergleichenden John Hopkins Projektes, URL: https://www.uni- muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/225, abgerufen am 09.01.2015.
3 Zimmer, A./Eckhard, P. (2001), S. 19, Die zunehmende Bedeutung des Dritten Sektors, Ergeb- nisse des international vergleichenden John Hopkins Projektes, URL: https://www.uni-muens- ter.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/225, abgerufen am 09.01.2015.
4 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 19
5 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6
6 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6
7 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6
8 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6
9 Vgl. Helmig, B./Boenigk, S. (2012), S. 6