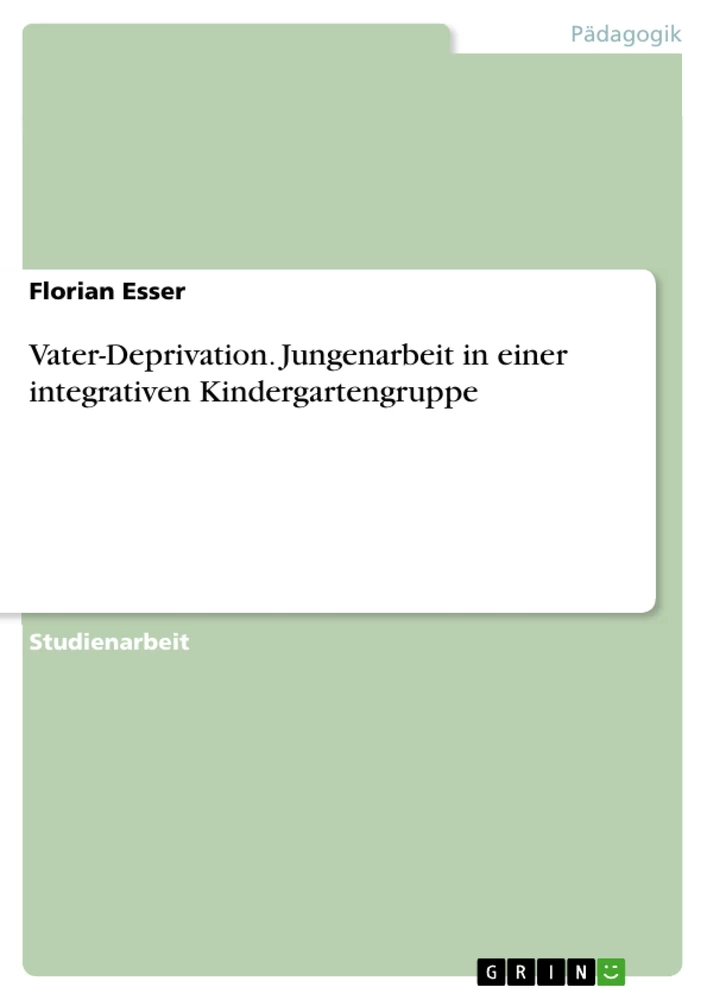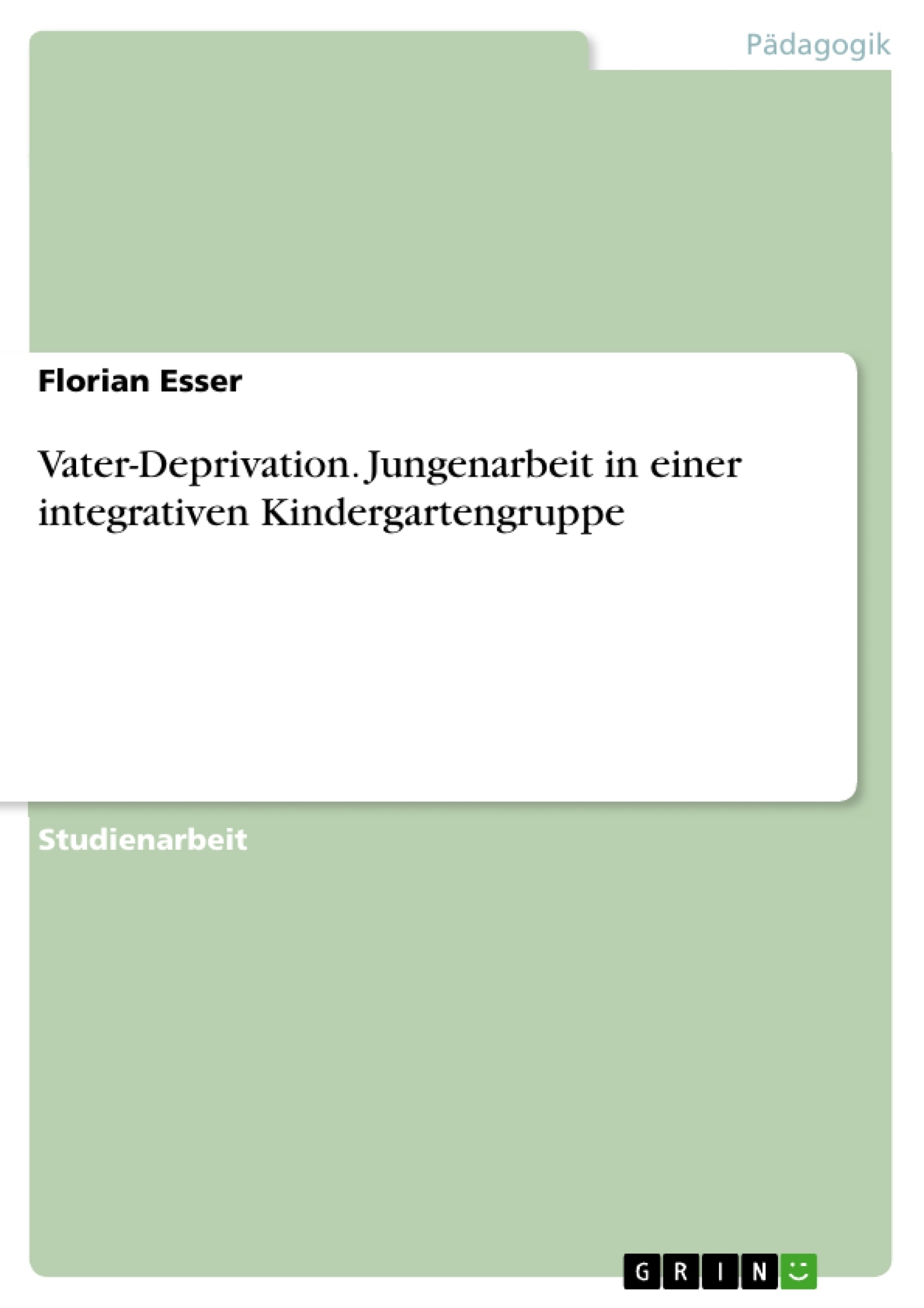In dieser Arbeit wird der Zusammenhang der vaterlosen Kindheit von Jungen bei gleichzeitiger, institutioneller Präsenz einer männlichen Bezugsperson untersucht.
Gerade bei Jungen ist die Abwesenheit des Vaters nicht leicht, da im Familiensystem ein wichtiger Platz unbesetzt ist und die Identifikationsfigur und das Rollenvorbild fehlen. Ein gleichgeschlechtliches Gegenüber ist nicht präsent, somit mangelt es an gelebter „Männlichkeit“, sowie einem streitbaren und greifbaren männlichen Gegenüber, mit dem das Kind in Beziehung treten kann.
Die nachfolgenden Erläuterungen, Signifikanzen, Begrifflichkeiten und Eindrücke sollen meine Arbeit visualisieren, sie begreifbar und nachvollziehbar machen, sowie einen Einblick geben, welch unvergesslichen Teilabschnitt ihres Lebens ich gemeinsam mit den Jungen gehen durfte.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
1.Stellenwert des Vaters in der Kernfamilie, Auswirkungen der Vater-Deprivation auf die Entwicklung von Jungen im Vorschulalter
1.1 Definition der Vater-Deprivation
1.2 Auswirkungen und Folgen der Vater-Deprivation
1.3 Familiensystemischer Platz und Aufgabenfeld des Vaters in der Erziehung seines Sohnes
2. Auseinandersetzung mit der Biografie und Persönlichkeit der Jungen
2.1 Beobachtungen als Grundlage zur Entwicklung von Handlungsstrategien
2.2 Analytische Auseinandersetzung mit der Biografie der Jungen, in Form von Anamnese und Aktenansicht
2.3 Pädagogische Rückschlüsse resultierend aus Beobachtung & Anamnese der Jungen
3. Professionalisierte Beziehungsgestaltung im Rahmen der Jungenarbeit unter Berücksichtigung der Vater-Deprivation
3.1 Methodischer Beziehungsaufbau und Reflexion erster Annäherungs- und Kontaktversuche
4. Fachtheoretische Relevanz von „Jungenarbeit“
5. Männliches und menschliches Rollenvorbild innerhalb der Jungenarbeit
6. Die Kunst der Liebe, Vergebung und Unvoreingenommenheit, bei gleichzeitiger Konsequenz und Struktur ohne zu sanktionieren
7. Geschlechtsbezogene Sozialisation und Erziehungsarbeit
8. Herausforderndes und Schwieriges im Umgang mit den Jungen
9. Ursache von Störungsbildern im Bezug auf die Vater-Deprivation
10. Positive Verhaltensänderung und sichtbare Erfolge (Gesamtreflexion)
11. Persönliche Entwicklung und Kompetenzerweiterung während des Praktikums (Resümee und Ausblick)
Nachwort
Literatur- und Quellenverzeichnis