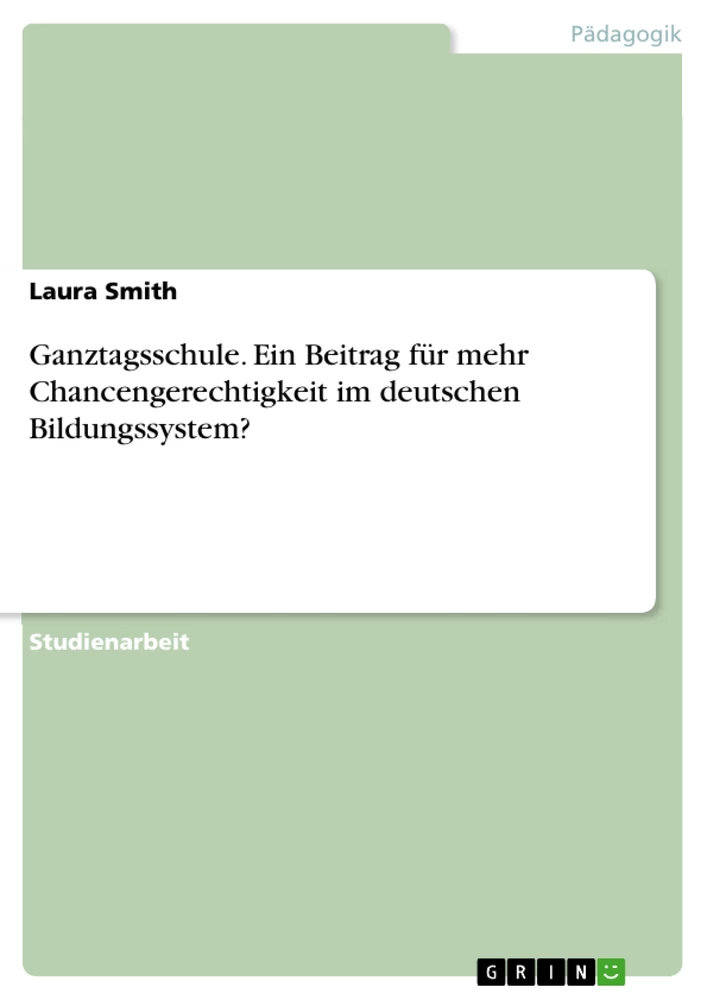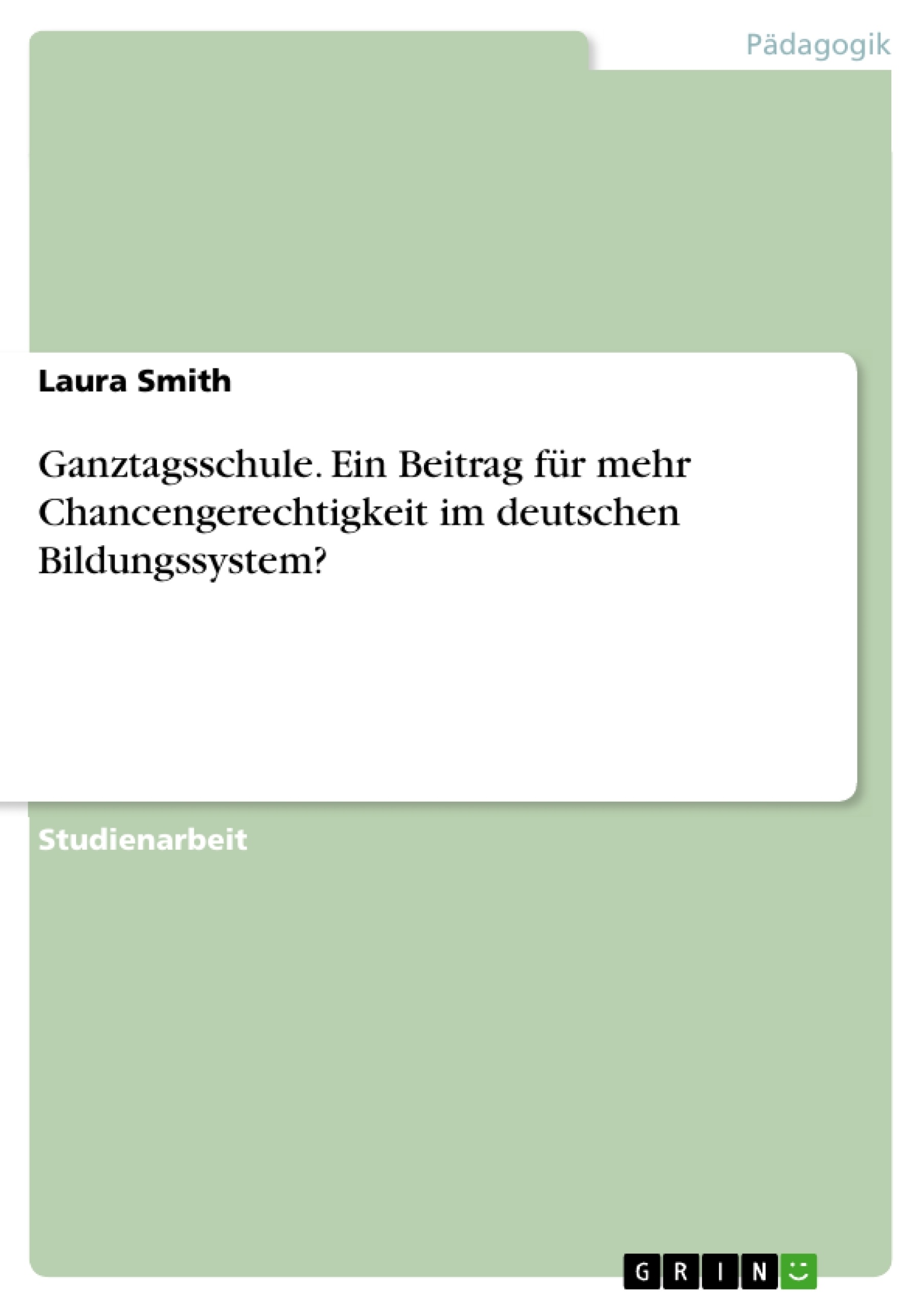Die PISA-Studie 2001 bescheinigte dem deutschen Schulsystem eine unzureichende Chancengerechtigkeit: In kaum einem anderen Land besteht ein so starker Zusammenhang zwischen Leistungsniveau und sozialer Herkunft. Kritiker führten den Misserfolg auf die überwiegend vorherrschende Halbtagsschule zurück, denn führend in den PISA-Studien waren vor allem die europäischen und außereuropäischen Länder, in denen die Ganztagsschule bereits zahlreich etabliert ist. Die vorliegende Arbeit möchte daher eine Antwort darauf finden, ob, wie und in welchem Rahmen von der Ganztagsschule tatsächlich eine kompensatorische Wirkung ausgeht.
Dabei wird in folgenden Schritten vorgegangen: Zunächst wird versucht den Begriff der Chancengerechtigkeit zu definieren. Aufbauend auf diesem Verständnis wird im nächsten Schritt das deutsche Bildungssystem daraufhin untersucht, um schließlich eine Situationsbeschreibung zur aktuellen Lage im deutschen Schulsystem zu liefern. Schließlich rückt die Ganztagsschule in den Fokus des Interesses. Zuerst werden definitorische Ansätze diskutiert, darauffolgend ein kurzer Abriss der aktuellen Ganztagsschulentwicklung gegeben, sowie ein Bild der aktuellen Lage in Deutschland gezeichnet. Abschließend widmet sich die vorliegende Arbeit ihrer zentralen Fragestellung, zu deren Beantwortung sie auch empirische Ergebnisse aus der deutschen Forschung heranzieht: Kann die Ganztagsschule einen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit leisten?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Fragestellung
2. Zur Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems
2.1 Zum Begriff ÄChancengerechtigkeit“
2.2 Die Chancengerechtigkeit des deutschen Bildungssystems
2.2.1 Die Integrationskraft des deutschen Bildungssystems
2.2.2 Die Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems
2.2.3 Die Kompetenzförderung im deutschen Bildungssystem
2.2.4 Die Zertifikatsvergabe im deutschen Bildungssystem
2.3 Zusammenfassung und Fazit
2.3.1 Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft
2.3.2 Bildungsungleichheiten nach Migrationshintergrund
2.3.3 Bildungsungleichheiten bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2.3.4 Fazit
3. Zentrale Ursachenkomplexe schichtspezifischer Bildungsungerechtigkeiten20
3.1 Primäre und sekundäre Effekte sozialer Herkunft
3.1.1 Primäre Effekte sozialer Herkunft
3.1.2 Sekundäre Effekte sozialer Herkunft
3.2 Primäre und sekundäre Effekte der ethnischen Herkunft
4. Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch den Ausbau von Ganztagsschulen!?
4.1 Begriffliche Annäherung an das Schlagwort ÄGanztagsschule“
4.2 Entwicklung der Angebotsstruktur und Schülerteilnahme an Ganztagsschulen in Deutschland
4.3 Chancen und Grenzen der Ganztagsschule zur Kompensation von Bildungsungleichheiten
4.3.1 Kompensation primärer Herkunftseffekte
4.3.1.1 Individuelle Förderung als grundlegendes Konzept zur Kompensation primärer Herkunftseffekte
4.3.1.1.1 In den Unterricht integrierte Förderung
4.3.1.1.2 Gezielte ergänzende Fördermaßnahmen
4.3.1.1.3 Förderung im Rahmen des Zusatz- und Neigungsprogramms
4.3.1.2 Empirische Belege zur individuellen Leistungsentwicklung
4.3.1.2.1 Wirkungen der Ganztagsschule auf das Sozialverhalten und auf das soziale Lernen
4.3.1.2.2 Wirkungen der Ganztagsschule auf kognitive und motivationale Variablen
4.3.1.2.3 Zusammenfassung der Befunde der StEG- Studie
4.3.2 Kompensation sekundärer Herkunftseffekte
4.3.3 Zusammenschau
5. Ganztagsschule - Stigmatisierung oder Nachteilsausgleich!?
6. Literaturverzeichnis