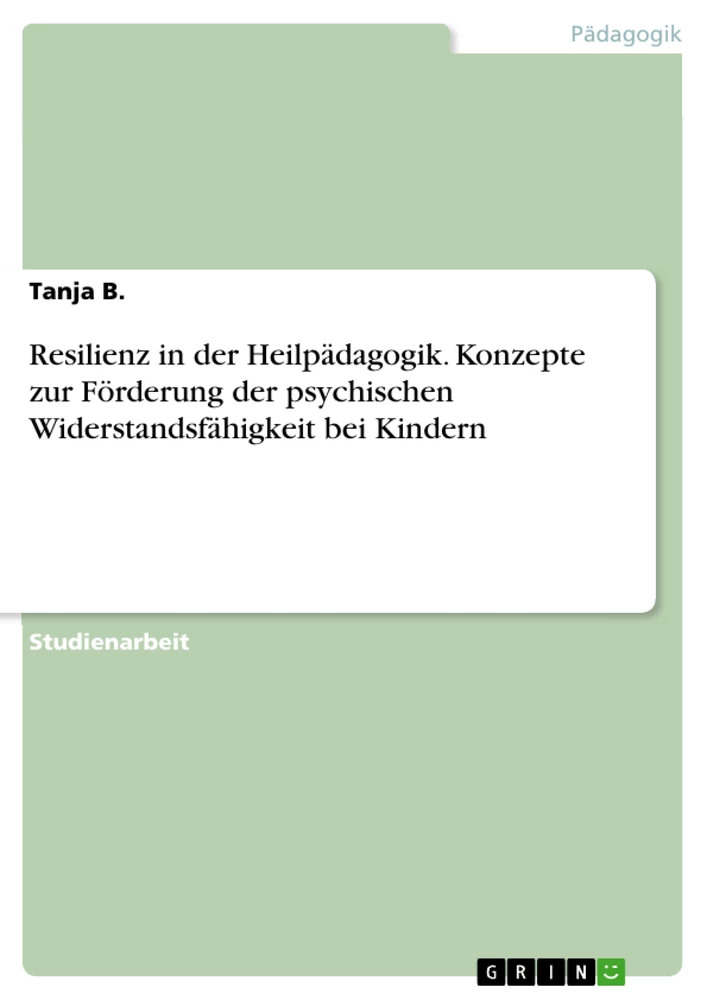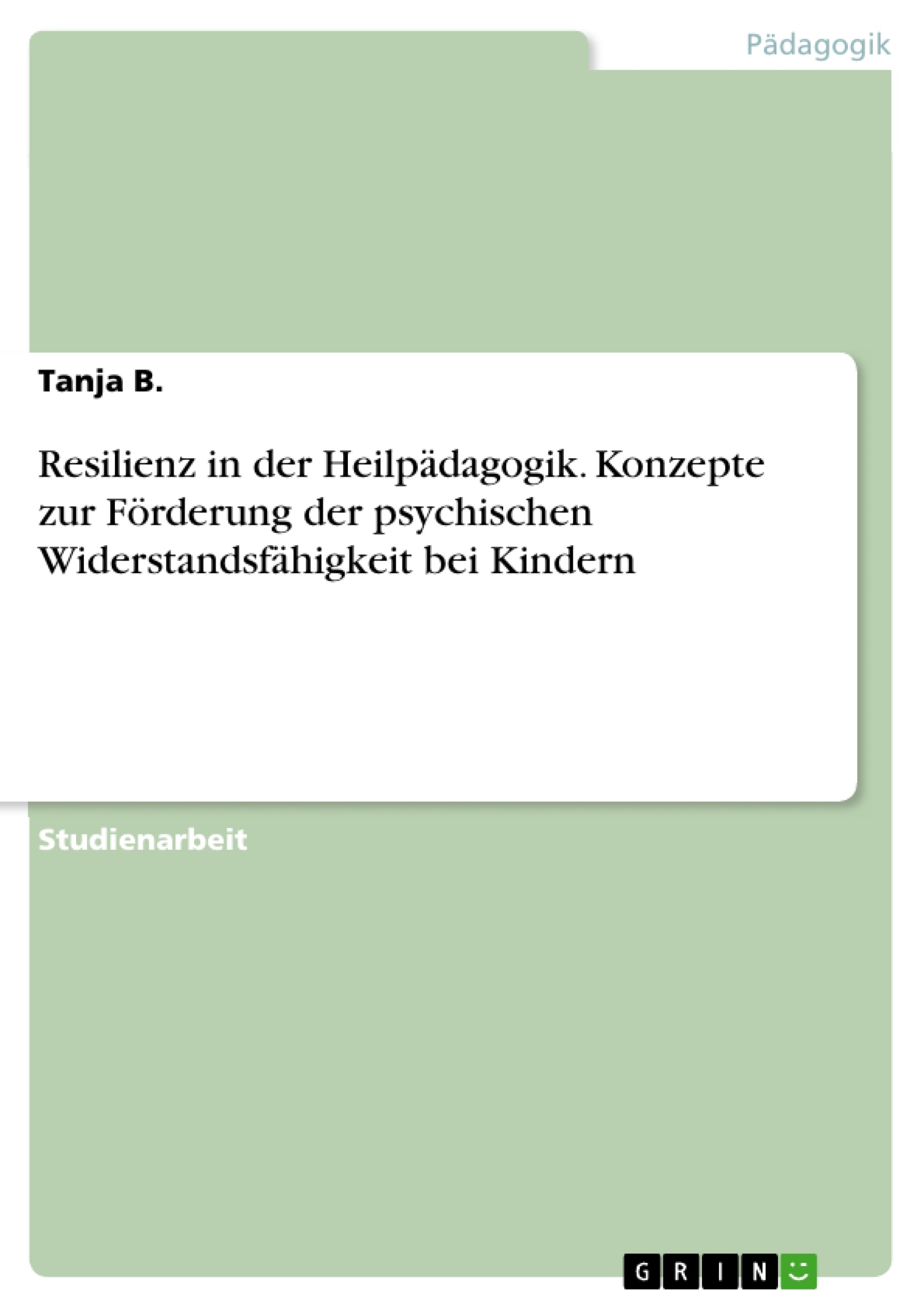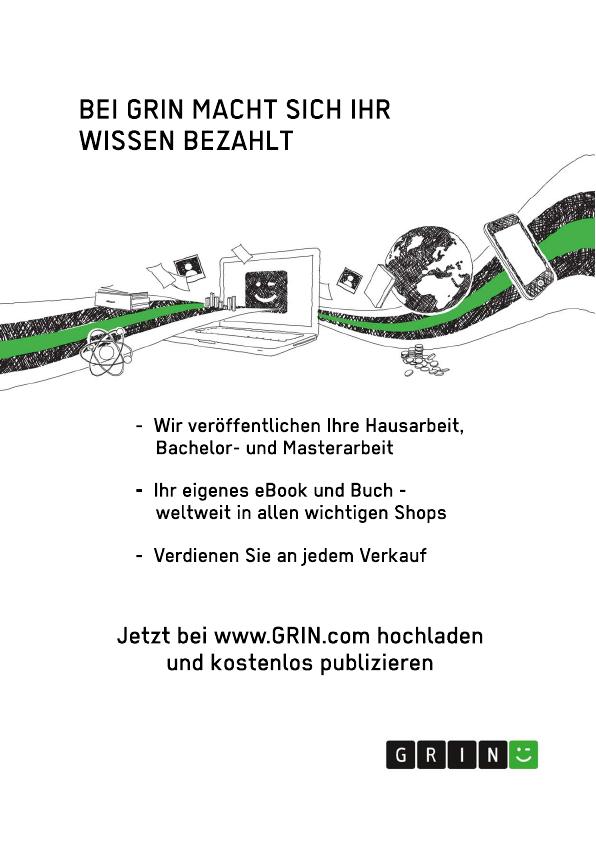Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Resilienz und Resilienzförderung. Im ersten Teil dieser Arbeit wird der Begriff Resilienz als Phänomen der psychischen Widerstandsfähigkeit definiert, dabei wird auf Risiko-, Schutz- und Resilienzfaktorenkonzepte eingegangen. Den Abschluss meiner Arbeit bildet die Auseinandersetzung bzw. Übertragung der Resilienzförderung auf den heilpädagogischen Bereich.
.
Inhalt
1. Einleitung
2. Resilienz / Begriffserklärung
3. Risiko- und Schutzfaktorenkonzept
3.1 Risikofaktorenkonzept
3.2. Schutzfaktorenkonzept
3.3 Das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren
4. Resilienzfaktoren als Schutzfaktoren des Kindes
5. Prävention - Bedeutung und Wirkung
6. Resilienzkonzepte und Förderung der Resilienz in der Heilpädagogik
7. Fazit
Literaturverzeichnis