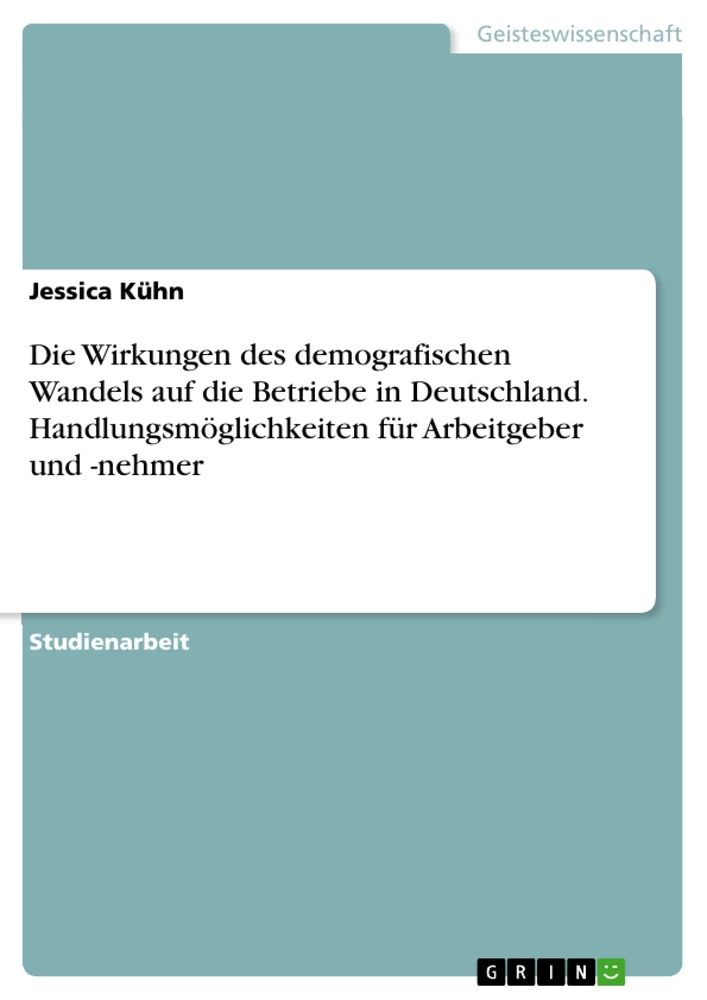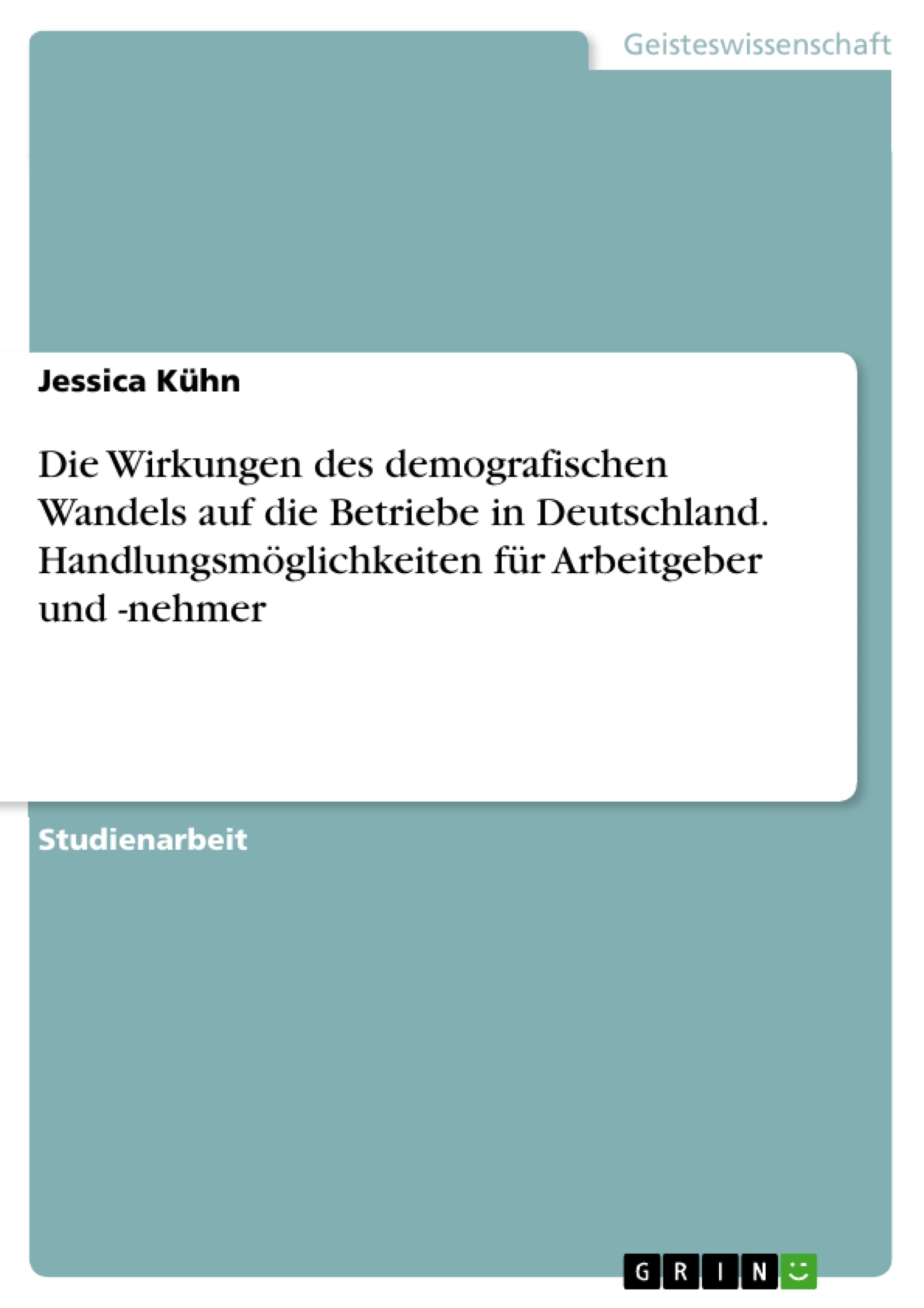In Deutschland zeichnet sich bereits seit den 1970er Jahren ein Wandel hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung ab. Während die Lebenserwartung immer weiter ansteigt, nimmt die Geburtenrate stetig ab. Diese demografische Alterung wirkt sich insbesondere auf den deutschen Arbeitsmarkt aus.
Die vorliegende Arbeit soll auf diese gegenwärtige Problematik aufmerksam machen und daraus folgernd die Frage beantworten, wie der demografische Wandel in den Betrieben Deutschlands wirkt.
Für die Analyse werden zu Beginn der Arbeit die theoretischen Grundlagen im Hinblick auf den demografischen Wandel erläutert. Im Anschluss daran werden die Wirkungen des Wandels auf den Arbeitsmarkt thematisiert, bevor mögliche Maßnahmen für die demografieorientierte Eingliederung der älteren Arbeitnehmer in den betrieblichen Ablauf vorgestellt werden.
Auf Grundlage näherer Ausführungen dazu soll die Arbeit mit der Beantwortung der anfangs gestellten Frage abschließen: Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die Situation in deutschen Betrieben aus und welche Möglichkeiten gibt es diesen zu begegnen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Demografie und demografische Prozesse in der Bundesrepublik
2.1 Der Demografiebegriff
2.2 Der demografische Wandel in Deutschland: Entwicklungen und Prognosen der Bevölkerungsentwicklung
2.3 Demografische Alterung
3. Die Wirkungen des demografischen Wandels auf Arbeitsmarkt und Be-schäftigung
3.1 Die Folgen der demografischen Alterung auf die Arbeitswelt
3.2 Kompetenzen und Beschäftigungsrisiken Älterer
3.3 Die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt: Erwerbstätigkeit im Alter
4. Maßnahmen für die demografieorientierte Eingliederung der älteren Arbeit-nehmer in die Betriebe
4.1 Betriebliches Personalmanagement - Anpassung der Arbeitsgestaltung im Betrieb
4.2 Individuelles Engagement des Arbeitnehmers: Lebenslanges Lernen und Eigenverantwortung für gesundes Altern
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis