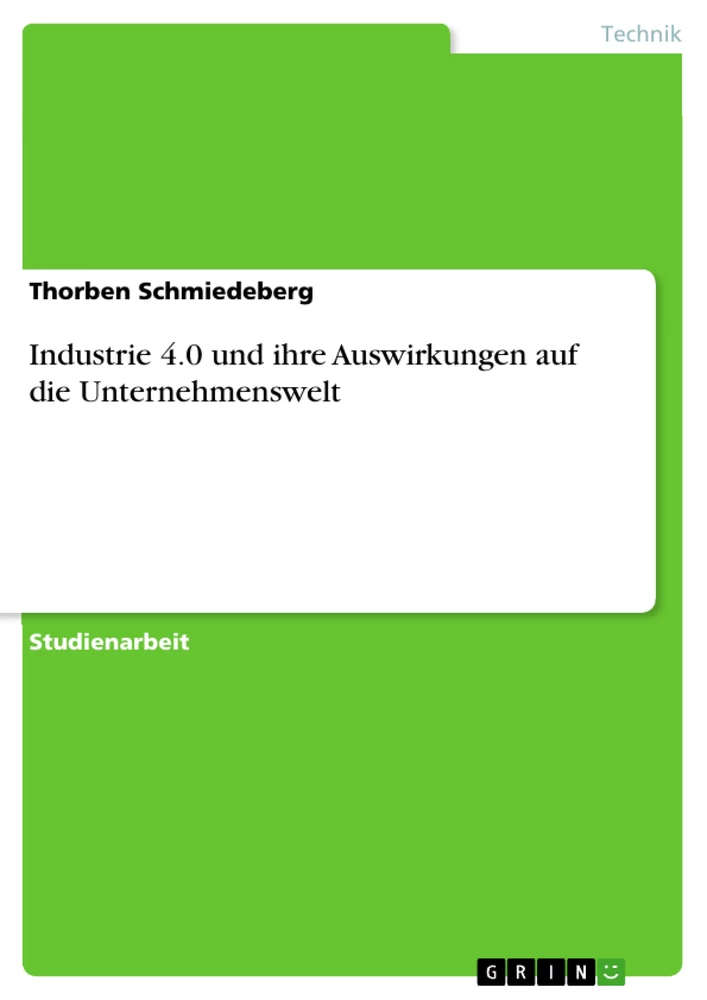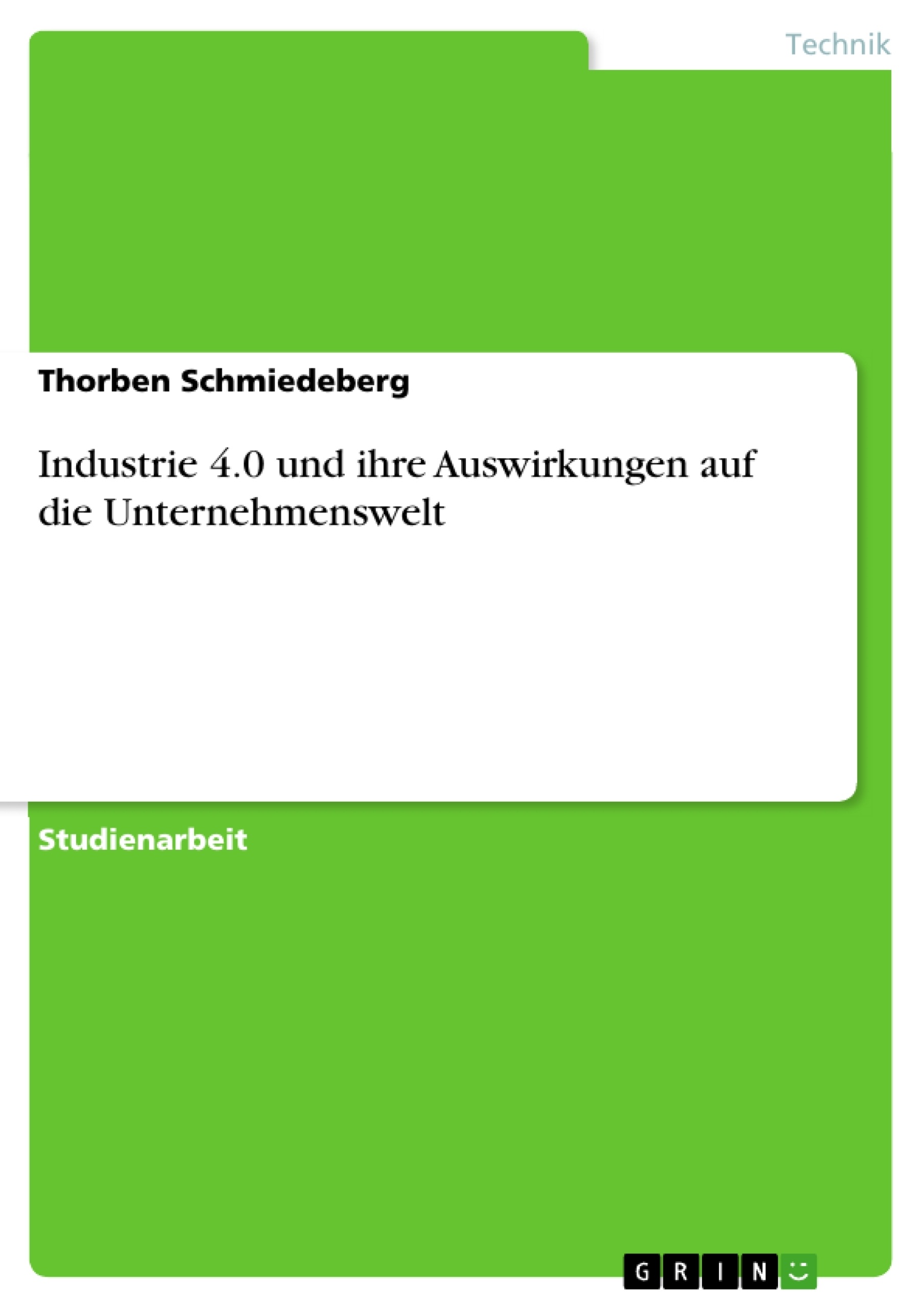Welche Auswirkung hat Industrie 4.0 auf die Unternehmenswelt. Die Beantwortung dieser Frage widmet sich die vorliegende Seminararbeit. Dies geschieht zunächst unter Betrachtung das historischen Kontext und der begrifflichen Abgrenzung / Definition von Industrie 4.0. Im darauffolgenden Abschnitt werden die neuen Technologien beschrieben.
Insbesondere die Cyber-Physischen Systeme spielen dabei eine primäre Rolle. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Auswirkung von Industrie 4.0 auf die Logistik. Unterteilt wird dies in Lager- und Produktionslogistik. Abschließend werden die wichtigsten Aspekte hinsichtlich Chancen und Risiken mit Hilfe der Literaturrecherche dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historischer Kontext
3 Industrie 4.0
3.1 Begriffliche Abgrenzung und Definition
3.2 Neue Technologien
3.2.1 Cyber-Physische Systeme
3.2.2 Cloud Computing
3.2.3 Kollaborative Roboter
4 Auswirkung auf die Logistik
4.1 Entwicklung der Logistik
4.2 Auswirkung auf die Lagerlogistik
4.3 Auswirkung auf die Produktionslogistik
4.4 Risiken und Chancen
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis