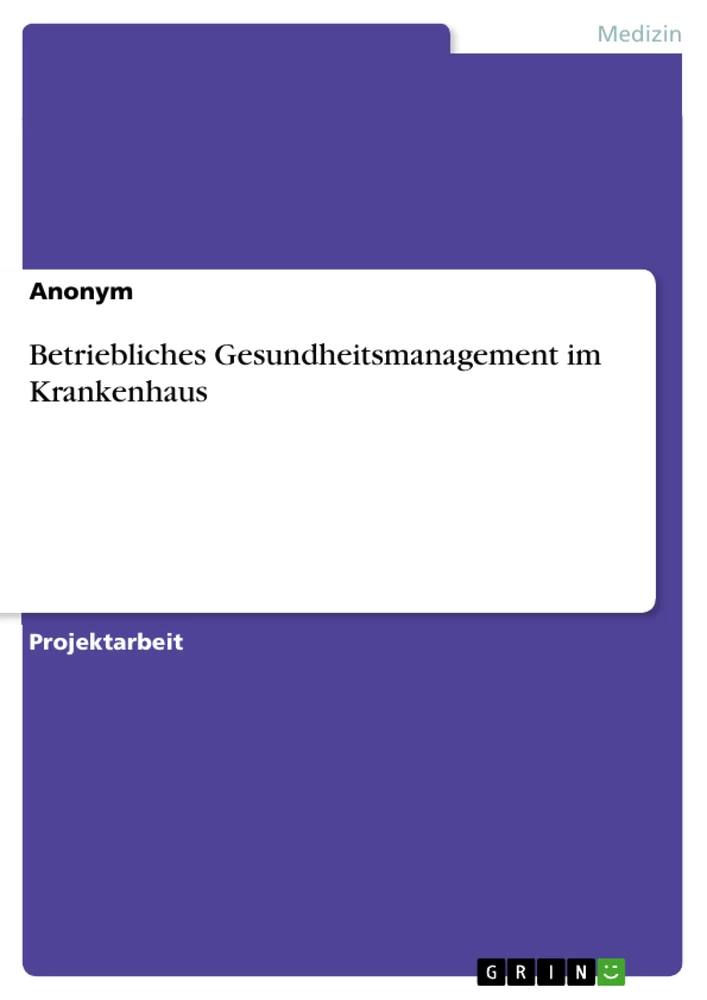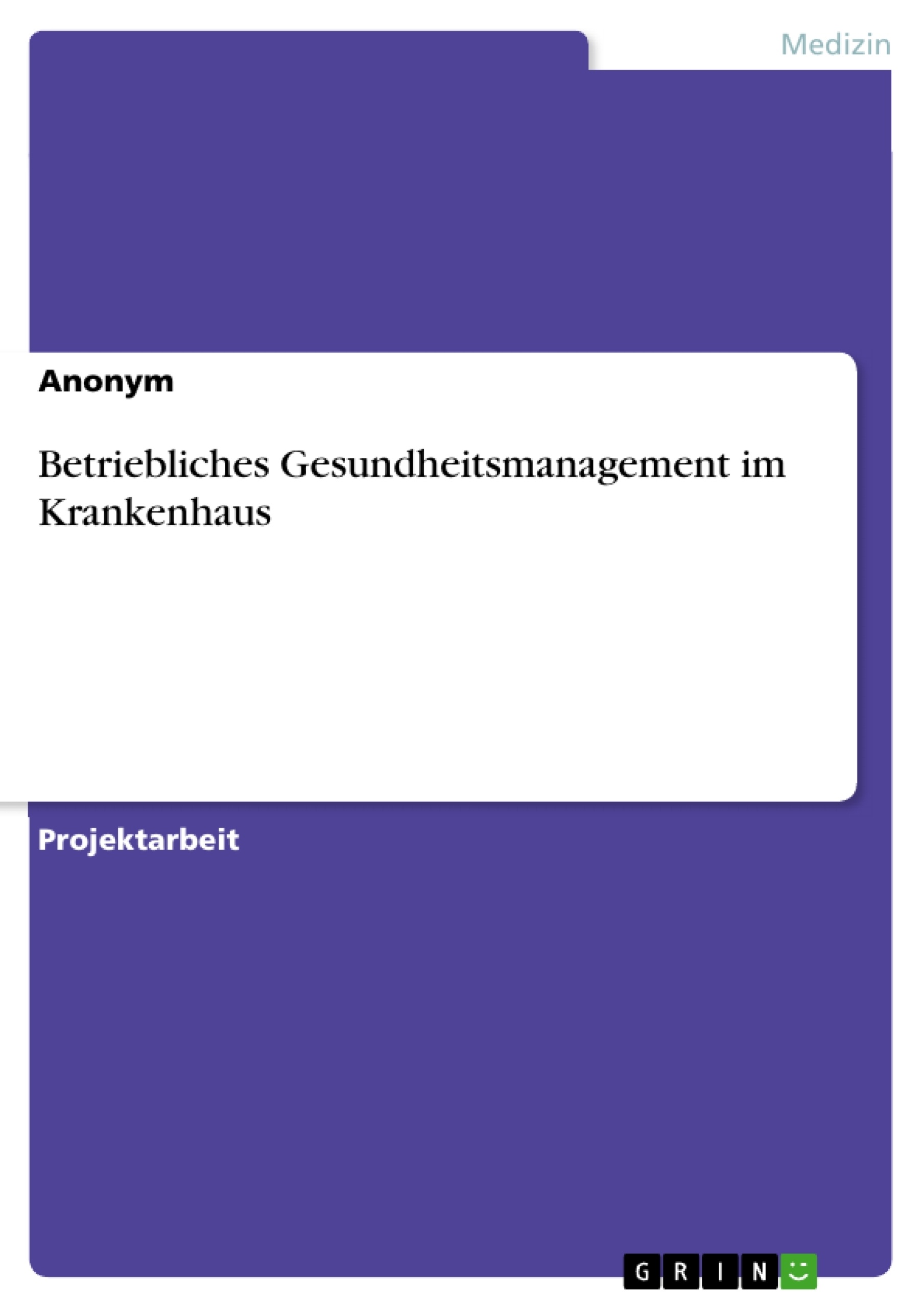Krankenpflegekräfte bilden mit ca. 517 000 Beschäftigten die größte Berufsgruppe in deutschen Krankenhäusern. Der Pflegeberuf gilt als schwieriger Beruf, da der unmittelbare, fast tägliche Kontakt zu Sterbenden und kranken Menschen, der Schichtdienst sowie andere belastende Arbeitsbedingungen Krankenschwestern und -pflegern ein hohes Maß an Energie abfordern und diese gezwungen sind, enorme Regenerationsleistungen zu erbringen. Das Risiko, selbst zu erkranken und vorzeitig aus dem Beruf auszuscheiden, ist für Pflegekräfte hinlänglich bekannt, jedoch trifft dies erst seit Zeiten des Pflegenotstands, hervorgerufen durch den demografischen Wandel, wieder auf öffentliches Interesse.
Trotz gesundheitspolitischer Umstrukturierungen in den Krankenhäusern in den letzten Jahren gilt betriebliches Gesundheitsmanagement häufig als „Luxusthema“. Die Zahl der Krankenhäuser, in denen systematisch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingeführt und umgesetzt wurden, ist im Vergleich zu anderen Branchen gering. Wie aus einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts von 2009 hervorgeht, ist die Umsetzungs- und Implementierungsquote von Systemen des betrieblichen Gesundheitsmanagements in deutschen Krankenhäusern als unbefriedigend zu bezeichnen. Nur 38% der befragten Häuser haben die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter in ihrem Leitbild verankert, messbare Ziele haben sogar nur 20% der befragten Krankenhäuser formuliert. Dies bedeutet, dass 80 % der Häuser keine konkrete strategische Ausrichtung hinsichtlich des betrieblichen Gesundheitsmanagements besitzen. Die oben genannten Fakten zeigen, dass dringender Bedarf besteht, Systeme und Strukturen in Krankenhäusern zu professionalisieren.
Die Motivation dieser Projektarbeit ist es, dem Leser zu veranschaulichen, welchen Belastungen Pflegekräfte im Krankenhaus ausgesetzt sind und herauszuarbeiten ob es möglich ist, Fehlzeiten von Pflegekräften im Krankenhaus mit Hilfe von Instrumenten des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu reduzieren.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Gesundheit
2.2 Das Krankenhaus
2.3 Das betriebliche Gesundheitsmanagement
3. Arbeitsplatz Krankenhaus
3.1 Die Arbeitssituation im Krankenhaus
3.2 Arbeitsinhalt von Pflegekräften
3.3 Belastungen von Pflegekräften
3.4 Fehlzeiten
3.4.1 Fehlzeiten von Pflegekräften im Krankenhaus
3.4.2 Erkrankungsarten
3.4.3 Kosten durch krankheitsbedingte Fehlzeiten
4. Betriebliches Gesundheitsmanagement im Krankenhaus
4.1 Aufgaben des betrieblichen Gesundheitsmanagements
4.2 Nutzen für das Krankenhaus
4.3 Kosten für das Krankenhaus
4.4 Der Zusammenhang von Gesundheitsförderung und Gesundheits-
management
4.5 Gesundheitsförderung von Pflegekräften
4.5.1 Ziele von betrieblicher Gesundheitsförderung
4.5.2 Maßnahmen
4.5.2.1 Gesundheitszirkel
4.5.2.2 Mitarbeiterbefragungen
4.5.2.3 Der betriebliche Gesundheitsbericht
4.5.2.4 Arbeitszeitgestaltung
4.5.2.5 Work-Life-Balance
4.5.2.6 Kinästhetik
5. Fazit und Ausblick
6. Literaturverzeichnis