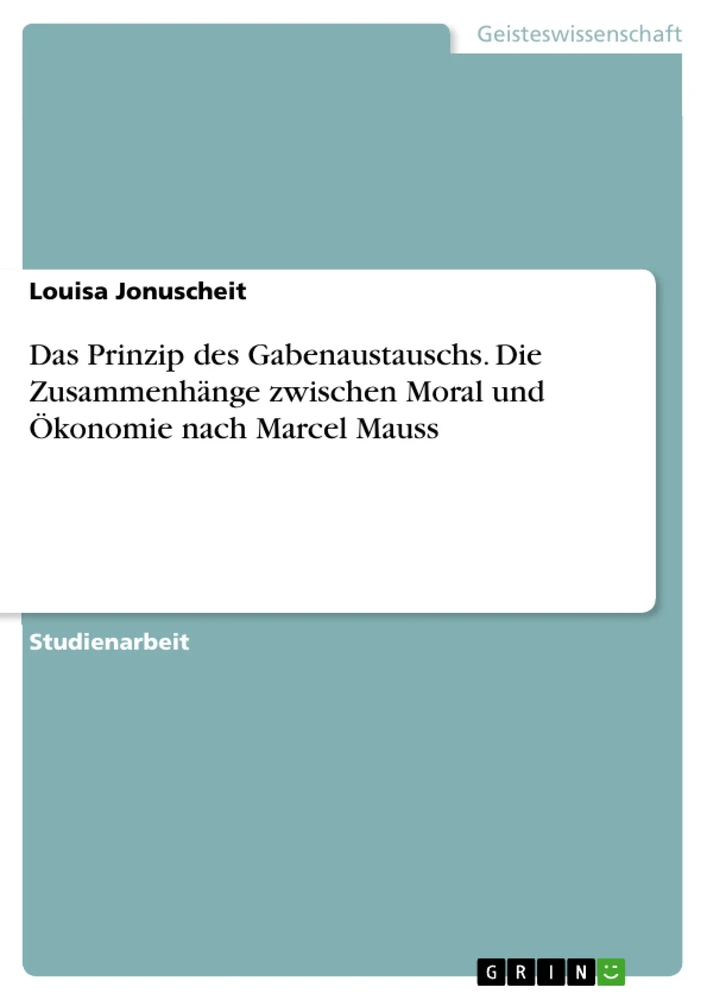Die vorliegende Hausarbeit behandelt die Theorie des Gebentauschs basierend auf dem Buch "Die Gabe" von Marcel Mauss. Im weiteren Verlauf wird vergleichend auf die Zusammenhänge in Bezug auf den Titel "Schulden. Die ersten 5000 Jahre" von David Graeber eingegangen.
Anfangs werden allgemeine Begriffsdefinitionen und rechtliche Bedingungen der Schenkung bzw. des Geschenks betrachtet.
Im Hauptteil werden wesentliche Aspekte von Marcel Mauss näher erläutert, sowie das Konzept der drei Verpflichtungen.
Nachfolgend werden die Zusammenhänge zwischen Gabe, Moral und Ökonomie betrachtet. Zum Ende folgt ein Rückblick sowie eine Kritik.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Definition des Begriffs ‚Geschenk‘ bzw. ‚Schenkung‘
Marcel Mauss
Hauptteil
Wesentliche Aspekte der Theorie des Gabentauschs von Marcel Mauss
Das Konzept der drei Verpflichtungen
Gabe & Ökonomie
Moral & Ökonomie
David Graeber zu Marcel Mauss
Schlussteil
Resümee
Kritik
Literaturverzeichnis
Vorwort
Ich möchte mich in meiner Hausarbeit mit der Theorie des Gabentauschs von Marcel Mauss auseinandersetzen. Weiterfolgend werde ich kurz auf ein neuzeitigeres Buch von David Graeber eingehen und erläutern, inwiefern sich dieser bei seinen Denkansätzen auf Marcel Mauss bezieht. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da ich mich sehr für den gesellschaftlichen Zusammenhang von Moral und Ökonomie interessiere. Mit der vorliegenden Arbeit versuche ich einen genaueren Einblick in das Gabenkonzept zu bekommen und einen Überblick darüber zu gewinnen, inwieweit sich Person und Sache miteinander vermischen können.
Einleitung
Definition des Begriffs ‚Geschenk‘ bzw. ‚Schenkung‘
„Geschenk, Gabe, frz.: don, in soziologischer und kulturanthropologischer Interpretation eine Institution, die zur Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen zwischen den sich gegenseitig Beschenkenden beiträgt. In vielen Kulturen ist der Austausch von Gaben rituell geregelt und religiös verankert (→ Potlach, → Kula). M. Mauss hat in seinem „Essaie sur le don“ (1923/1924). Die Bedeutung der Institution des Gebens als eines → „sozialen Totalphänomens“ mit gleichzeitig rechtlicher, wirtschaftlicher, religiöser, ästhetischer und sozialmorphologischer Funktion betont.“ (Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt, & Wienold, 2013)
Menschen gehen soziale Beziehungen miteinander ein und versuchen diese aufrecht zu erhalten. Beziehungen entstehen auf der Basis einer Zweckerfüllung, dienen folglich dem eigenen Vorteil oder werden zumindest unter diesem Aspekt geschlossen. Mit diesem Hintergrund gibt man auch. Menschen geben, weil sie eine Gegengabe erwarten. Unmittelbar oder mit dem Hintergedanken eines späteren Vorteils. Es geht bei dem Gabenaustausch um eine Gegenseitigkeit, eine Reziprozität des Gebens und Nehmens. In der heutigen Gesellschaft gibt es unzählig viele Ereignisse zu denen geschenkt wird, wobei es wiederum auch erwartet wird. Somit kann das Schenken als Pflicht betrachtet werden. Dazu zählen zum Beispiel bestimmte Anlässe wie: Ostern, Weihnachten, Geburtstage, Valentinstag, Nikolaus. Die Schenkungen zu solchen Anlässen gelten bereits als Rituale, da sie habitualisiert sind. Hierzu haben die Menschen unterschiedliche Erwartungshaltungen, zu welchen Anlässen und in welchem Format ein Geschenk als angebracht gilt. Dies ist nicht zuletzt auch von der persönlichen sozialen Beziehung zueinander abhängig.
Das Schenken hat sich über Jahrzehnte in der Gesellschaft etabliert und wird auch durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert:
§ 516 Begriff der Schenkung
(1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__516.html, kein Datum).
Auffällig hierbei ist, dass das Gesetz die Schenkung als eine einseitige Handlung definiert. Vergleicht man dies mit der Definition aus dem Lexikon, so stellt man zwei unterschiedliche Auffassungen fest. Diese Auffassungen stehen im Widerspruch zueinander. Juristisch betrachtet ist die Schenkung eine einseitige Handlung. Laut Gesetz kann kein Gegengeschenk eingefordert werden. Dennoch wird ein Gegengeschenk in der Gesellschaft erwartet und als Beschenkter steht man folglich im Erwiderungszwang. Der Gabenbegriff steht also in sich im Widerspruch, worauf ich im Hauptteil genauer eingehen werde.
Marcel Mauss
Marcel Mauss war ein französischer Anthropologe, Soziologe und Ethnologe. Er ist 1872
geboren und verstarb 1950. Zusammen mit seinem Onkel und Mentor, Emile Durkheim, gründete er die Zeitschrift L’Année Sociologique. “Mauss war jedoch weniger Philosoph als Durkheim. In allen seinen Essays wendet er sich zuerst den konkreten Tatsachen zu und prüfte sie in ihrer Gesamtheit und bis zum letzten Detail.“ (Mauss, 1990, S. 9). Er war SanskritForscher und Religionshistoriker, dessen Hauptaugenmerk auf der Religionsforschung und Religionssoziologie lag. In seinen Forschungen versucht er das ‚Totale‘ zu erfassen. Seine Vorgehensweise ist stark empirisch orientiert: „Er tat bei seinen Forschungen am Schreibtisch, was ein Anthropologe im Feld tut, nämlich mit einem geschulten Verstand das Leben primitiver Völker beobachtend und erlebend zu erfassen.“ (Mauss, 1990, S. 10).
Hauptteil
Die von Marcel Mauss genutzte Methode bezieht sich auf vorhergegangene Untersuchungen in Polynesien, Melanesien und Nordwestamerika. Des Weiteren werden einige größere Rechtssysteme miteinbezogen. Die Rituale und Praktiken der verschiedenen Stämme werden genauer analysiert, um daraus Gründe für den Gabentausch in archaischen Gesellschaftten abzuleiten. „Das Organisationsprinzip archaischer Gesellschaften beruht auf Blutsverwandtschaft und baut damit also unmittelbar auf dem auf, was biologisch gegeben ist. Eine beschränkte Anzahl von Personen lebt im sozialen Verband einer Horde. Sofern die Horde grösser wird, kann sie sich in verschiedene Sippen aufteilen. Damit kommen wir zu einer segmentären Stammesorganisation. Ein in einer solchen Gesellschaft lebendes Individuum erhält seine Identität durch die verwandtschaftliche Position, die es inne hat. (…) In unserer heutigen Gesellschaft ist das archaische Organisationsprinzip ebenfalls noch in Form verwandtschaftlicher Strukturen vorhanden, wobei es aber schon längst seinen dominanten Status verloren hat. (…) In Form des privaten Bereichs spielt der gewissermassen archaische Teil unseres Lebens aber natürlich immer noch eine wichtige Rolle. Dieser Bereich macht sich auch im räumlichen Sinne bemerkbar, indem man dort, wo sich die sozialen Praktiken des privaten Bereichs abspielen, vom privaten Territorium reden kann.“ (http://www.humanecology.ch/index.php?lng=de&pag=9&nav=3&sub=6&spg=326, kein Datum).
Wesentliche Aspekte der Theorie des Gabentauschs von Marcel Mauss
„In den Wirtschafts- und Rechtsordnungen, die den unseren vorausgegangen sind, begegnet man fast niemals dem einfachen Austausch von Gütern, Reichtümern und Produkten im Rahmen eines zwischen Individuen abgeschlossenen Handels. Zunächst einmal sind es nicht Individuen, sondern Kollektive, die sich gegenseitig verpflichten, die austauschen und kontrahieren; die am Vertrag beteiligten Personen sind moralische Personen: Clans, Stämme, Familien, die einander gegenübertreten, seis als Gruppen auf dem Terrain selbst, seis durch die Vermittlung ihrer Häuptlinge, oder auch auf beide Weisen zugleich.“ (Mauss, 1990, S. 21-22). Anhand dieses Zitats wird deutlich, dass sich der Gabenaustausch hauptsächlich innerhalb von Kollektiven abspielt und weniger Individualpersonen betrifft.
Marcel Mauss spricht von „‘totalen‘ gesellschaftlichen Phänomenen“ (Mauss, 1990, S. 17), die ihren Ausdruck im Gabenaustausch finden. Hierbei betrifft der Austausch nicht nur „wirtschaftlich nützliche Dinge“ (Mauss, 1990, S. 22), sondern auch nichtmaterielle Dinge, wie zum Beispiel Höflichkeiten und Rituale. Der Gabenaustausch beruht auf verschiedenen Strukturen, die ökonomischer, politischer, juristischer, moralischer und religiöser Natur sein können. Er impliziert Verträge, die einen symbolischen Charakter haben.
[...]