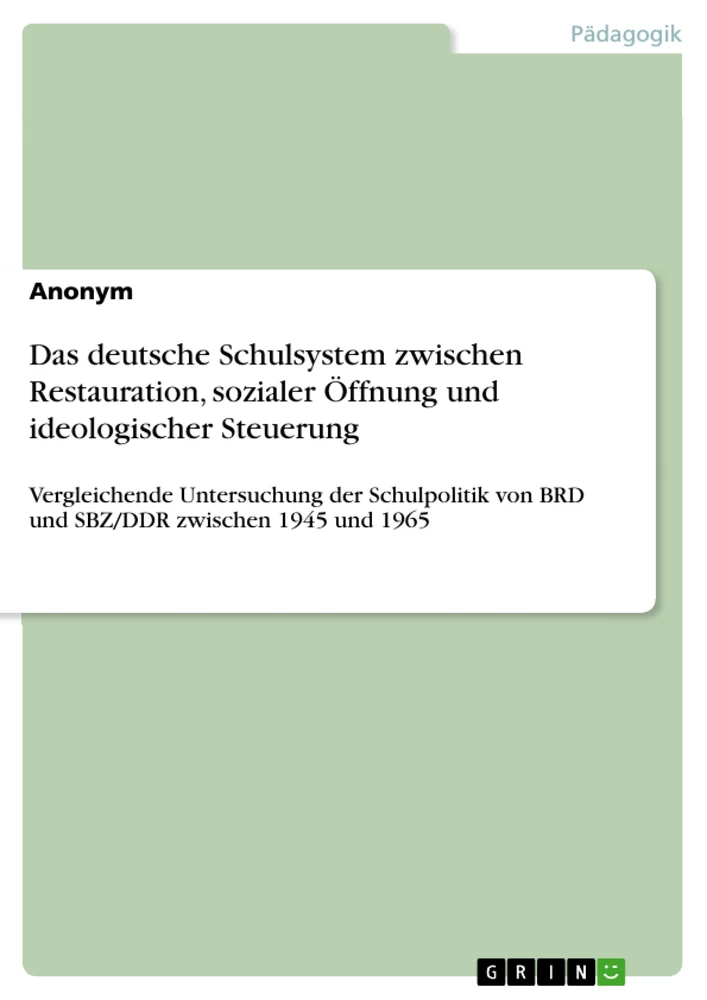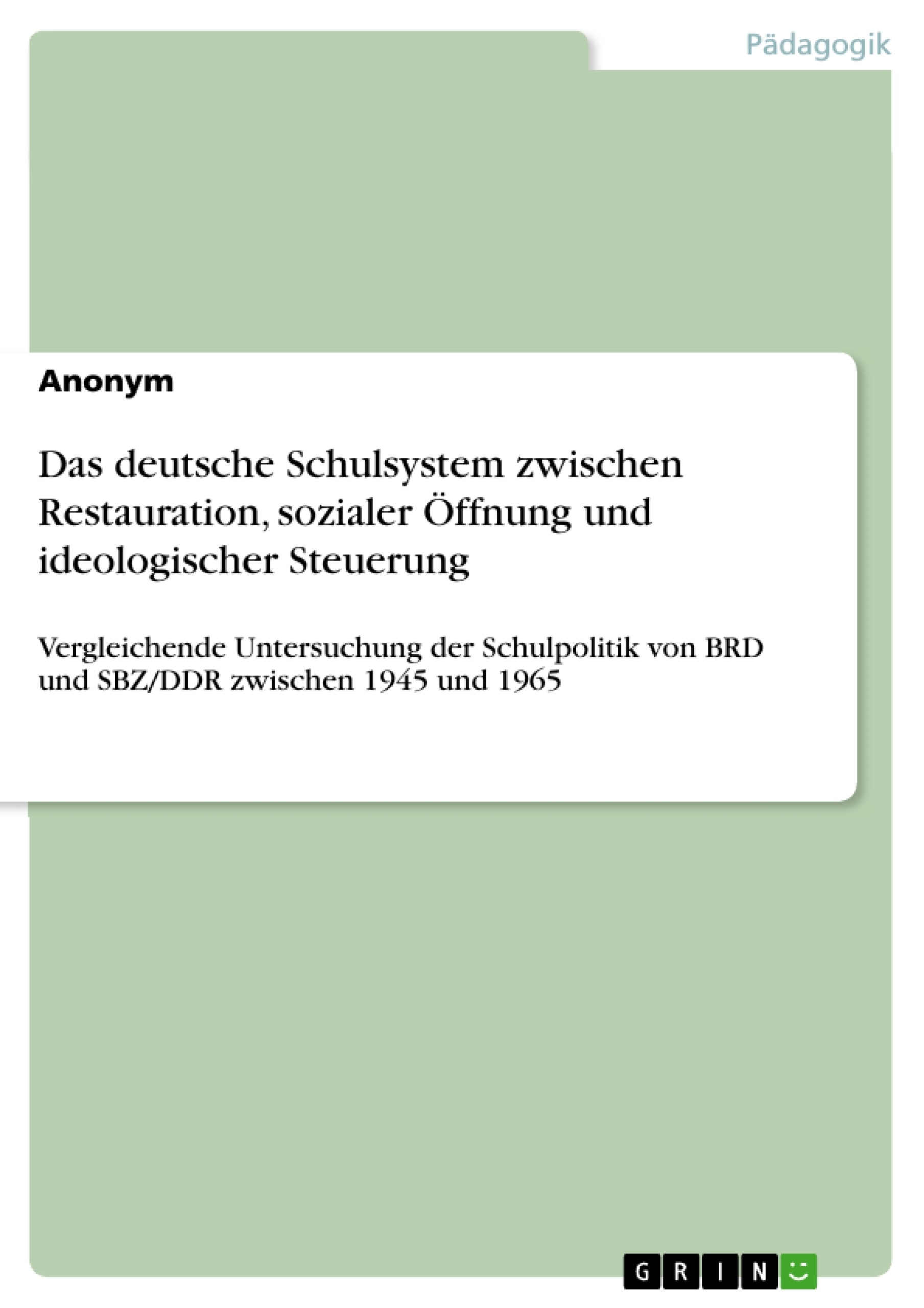In dieser Ausarbeitung geht es um die Theorie und Geschichte des gegliederten Schulwesens in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Restaurationsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg sowie um die Schulbildung in der SBZ/DDR.
Es wird der Frage nachgegangen, ob es nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit für einen schul- und bildungspolitischen Neubeginn gab, wer in welcher Form an Entscheidungen beteiligt war und welche Positionen repräsentiert wurden (vgl. Wilhelmi, 1979, S.21).
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Der Begriff Reformpädagogik
3 Die Restauration des Schulwesens in der Bundesrepublik von 1945 bis 1965
4 SBZ/ DDR: Schule zwischen sozialer Öffnung und ideologischer Steuerung 1948/49 - 1959
5 Kritik an dem Bildungssystem
Literaturverzeichnis
1 Einführung
In dieser Ausarbeitung geht es um die Theorie und Geschichte des gegliederten Schulwesens in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Restaurations-periode nach dem zweiten Weltkrieg sowie um die Schulbildung in der SBZ/DDR.
Es wird der Frage nachgegangen, ob es nach dem zweiten Weltkrieg 1945 die Möglichkeit für einen schul- und bildungspolitischen Neubeginn gab, wer in welcher Form an Entscheidungen integriert war und welche Positionen repräsentiert wurden (vgl. Wilhelmi, 1979, S.21).
Warum beschäftigen wir uns heute mit der Zeit der Besatzungsherrschaft und den dort getroffenen schulpolitischen Entscheidungen?
Es gibt drei nennenswerte Gründe dafür: Zum einen ist heute wie damals im schulpolitischem Zusammenhang die strittige Anordnung der Ruf nach der Gesamtschule. Häufige Vorschriften in den Länderverfassungen schreiben das dreigliedrige Schulwesen fest. Wenn man heute eine Neuordnung ausrichten will, so findet man die Kräfte und Argumente, die nach 1945 wirkten. Außerdem wurde nach 1945 versucht ein Einheitsschulsystem zu errichten, weshalb man heute wissen sollte welche Kräfte und Meinungen die Reformen nach 1945 nicht gestatteten, sodass man beurteilen kann, mit welchen reformbedeutenden Kräften man heute Vertraut sein muss. Zum anderen wurde nach 1945 in der damaligen sowjetisch besetzten Zone binnen kurzem ein Einheitsschulsystem durchgesetzt, was mittlerweile die Einheits- oder Gesamtschule mit der Vorstellung der "sozialistischen Gleichmacherei" aufweist (vgl. Lange-Quassowski, 1979, S.71).
Nach 1945 konnte nun nicht nur das Alte rekonstruiert, sondern auch etwas Neues geschaffen werden. Jedoch standen sich nicht mehr nur Schulreformbefürworter, die die Einheitsschule und Chancengleichheit fordern, und Reformgegner gegenüber, sondern auch die externen Besatzungsmächte griffen in die Diskussion mit klaren Forderungen ein, denn besonders "die Amerikaner waren mit der Absicht der Demokratisierung des deutschen Bildungswesens" (Lange-Quassowski, 1979, S.16) angetreten.
Im Folgenden soll untersucht werden, warum die Möglichkeit der Schulreform nach 1945 verfehlt wurde und es zur Restauration des Schulwesens in Deutschland führte.
2 Der Begriff Reformpädagogik
Der Begriff Reform rührt aus dem Lateinischen her, von “reformare“ abgeleitet und bedeutet: „pädagogische Bewegung, die von der Psychologie des Kindes ausgehend seine eigene Aktivität und Kreativität fördern will und sich gegen die Lernschule wendet" (vgl. Duden Online). Ein „Reformator“ war derjenige, der bestehende Beziehungen so ändert, dass sich ein neuer Sinn resultierte. Im 16. Jh. beeinflussten unter anderem M. Luther den Begriff „Reformation“. Die Forderung der Reformation war eine Erneuerung des Glaubens und eine Rückbesinnung auf Richtlinien und Grundsätze. Heutzutage wird in der Politik öfters über Reform geredet. Die Reformpädagogik entstand zwischen 1880 und 1932, die aus der Reformation des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens bestand (vgl. Hedderich, 2001, S. 18). Ein gesamtgesellschaftlicher Wendepunkt kam zur Zeiten der Industrialisierung, wodurch sich auch pädagogische Systeme auf dem Prüfstand befanden. Eine Gemeinsamkeit, das alle Reformpädagogischen Entwürfe teilen, ist, dass das Kind mit seiner Individualität im Zentrum steht, mit dem Ziel die Alte Schule zu reformieren und die Prügelstrafe abzuschaffen. Im Unterricht sollen die Schüler zielbewusst mitarbeiten und ihre Kindheit nicht mehr als eine Entwicklungsphase und die Kinder nicht mehr als kleine Erwachsene zu sehen, sondern die Erziehung selbst soll Ausgangspunkt sein. Die Besonderheit der Reformpädagogik ist die spezielle Zuneigung zum Kind (vgl. Hedderich, 2001, S. 19 f.).
3 Die Restauration des Schulwesens in der Bundesrepublik von 1945 bis 1965
In der Phase nach 1945 bestimmte in der Öffentlichkeit ein großer Pluralismus in Bezug auf die Themen Erziehung, Schule und Bildung. Es galt als bildungs-historische zentrale Phase, in der strukturelle und politische-ideologische Entscheidungen bezüglich des sozialistischen Bildungssystems bestimmt wurde. Außerdem entstanden Ansätze einer sozialistischen Pädagogik durch Fundamental-kritik an der spätbürgerlichen pädagogischen Tradition. Es entstand zu dieser Zeit ein staatliches Einheitsschulsystem, in dem die Grundschule für alle Kinder acht Jahre, die Oberstufe vier Jahre dauerte und die Berufsausbildung konnte in zwei bis drei Jahren beendet werden. Das Denken entsprach einer klaren Abwendung vom Nationalsozialismus. Daher kam es zu einer personellen Ausbesserung der gesamten Lehrerschaft. Nun trat eine neue Generation von Pädagogen in den Dienst der antifaschistisch- demokratischen Erziehung. Die Gedanken des Antifaschismus, der Demokratie und der Wissenschaft waren in den höchsten Bildungseinrichtungen anerkannt. Eine entsprechende strukturelle und gesellschaftspolitische Veränderung sowie eine politische Notwendigkeit führte zur Forderung einer Pädagogik-entwicklung. Die Schule galt als ein wichtiges Mittel der Volkerziehung, indem die schulpolitische Absicht der SED als Erziehungsziel dominierte. Zu diesen Zielen zählten Demokratie, demokratischer Patriotismus, Humanismus, Internationalismus, Solidarität. Ein normatives Erziehungs- und Bildungsideal überwog die schul-politische Diskussion, das seit 1948 dogmatische und indoktrinierende Züge annahm. Die von Anfang an unterschiedliche Politik der alliierten Besatzungs-mächten in den Besatzungszonen versuchten eine erneute aggressive und expansionstische deutsche Politik dauerhaft entgegenzutreten. Der Grund für den Unterschied ist in den politischen Systemen, die schon 1946/47 deutlich wurden (vgl. Anweiler, 1992, S. 63).
Nach Kriegsende wurden in allen Zonen vorerst alle Schulen vorläufig geschlossen. Die nationalsozialistische Bildungspolitik wendete sich dem traditionellen Schulwesen ab und ergänzte die Vereinheitlichung und Aufwertung der Mittelschule. Nach dem Kriegsende im Jahr 1945 wurde schnellstmöglich versucht die Schulbildung wiederaufzubauen und zu organisieren. Schulen unterschiedlichen Typs wurden zusammengefasst und Lehrer verschiedener Schularten unterrichteten zusammen, außer bei Ausnahmesituationen. Da in dieser kurzen Zeit weder ausreichendes neues Lehrmaterial gesammelt werden konnte, noch die Lehrkonzepte planvoll durchdacht waren, knüpfte man in den Schulen zunächst an die Weimarer Republik an. Als Motiv galt es die Schule zu einem ordentlichen Betrieb zu verhelfen, sowie Kinder und Jugendliche ohne Eltern oder ohne zu Hause in den reparierten Schulen unterzubringen. Auch wenn die Wiedereröffnungen ungenügend vorbereitet waren, wurde dies akzeptiert, um die Jugend von den Straßen zu holen. Aufgrund der zahlreichen Zerstörungen der Schulräume besonders in Großstädten wurde bis Mitte der 50er Jahre noch Schichtunterricht abgehalten (vgl. Hearnden, 1973, S. 17). Beim Wiederaufbau wurden gleichzeitig auch verschiedene Gruppen gegründet, die unterschiedliche Bildungspolitische Bewegungen folgten und eine Veränderung des Schulwesens anforderten. Ein gemeinsamer Bezugspunkt war die National-sozialistische Herrschaft, die nicht mehr geduldet werden sollte. Man befasste sich nicht nur mit dem Bereich der Bildung, sondern auch das politische System spielte eine Rolle, die die Bildungsreforminitiativen einen kleinen Teil der tief greifenden Gesellschaftsreform ausmachten. Die alliierten Besatzungsmächte und inner-deutsche politische Organisationen und Einzelpersonen, die in der Nazizeit unterdrückt wurden, sind Träger der Reforminitiativen. Notwendige Veränderungen waren bei der umfassenden Revision der Inhalte schulischen Lernens, beim Abwechseln des an der nationalsozialistischen Herrschaft beteiligten Lehrer-personals und bei Veränderungen der Schulstruktur. Diese Ansätze befanden sich in den Programmen der vier Besatzungsmächte, die auf eine grundlegende Demokratisierung der Schule zielten und verbündeten damit an republikanische, nicht- sozialistische Traditionen der Schulreform an (vgl. Herrlitz et al., 2009, S. 158).
Im Potsdamer Abkommen bestimmten die Alliierten für alle Besatzungszonen, dass das Erziehungswesen so neu zurechtgelegt sei, „dass die nazistischen und militaristischen Lehren völlig entfernt werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht“ werde (Faust, 1959, S. 73). Diese Festlegung wurde in den verschiedenen Besatzungszonen unterschiedlich beurteilt. Zudem hatte jeder der Alliierten schon zu Kriegszeiten sein eigenes Konzept angefertigt, wie im Bildungs- und Erziehungswesen vorzugehen sei. Auf der Potsdamer Konferenz wurde sich also längst nicht auf eindeutige und einheitliche Grundsätze geeinigt (vgl. Hearnden, 1973, S. 16).
Vorrangig begonnen die USA mit ihrem „Re-education“ Programm und gingen sehr strikt bei der Entnazifizierung vor. Großbritannien jedoch hielt sich zu diesem Thema zurück und Frankreich blieb im Bezug auf die Entnazifizierung ohne rechtes Konzept (vgl. Kleßmann, 1991, S. 92- 94). Somit wurde keine wirkliche Reform von den Besatzern der späteren Bi-Zone vorausgesetzt. Obwohl die USA und Großbritannien korrespondierten, dass eine Schulreform von den Deutschen selbst zu entwerfen und zu gestalten sei, fiel diese Reform weg, sodass sich die USA entschließt 1946 selbst intervenieren Sie unterstützen die sechsjährige Grundschule und die weiterführende Schule als Gesamtschule. Zudem sollten gesonderte Schularten abgeschafft werden, die Schulpflicht und Schulgeld- und Lernmittelfreiheit sollte bis zum 15. Lebensjahr eingeführt werden. Da das deutsche Volk den Wiederaufbau selber entwerfen und durchführen sollten, wollten die USA dieses System Deutschland nicht aufdrängen, sondern nur vorschlagen. Jedoch wurde diesem Rat zu keiner Umstrukturierung zugesprochen (vgl. Hearnden, 1973, S. 19- 20). Großbritannien hingegen blieb eher unbeteiligt und hielten das traditionelle dreizügige System Volksschule, Mittelschule und Gymnasium fest. Mit der Zeit wurden den deutschen Länderregierungen alle Entscheidungen abgegeben (vgl. Hearnden, 1973, S. 17- 18). Die Besatzungsmacht Frankreich versuchte bis 1949 das französische Schulsystem, welches auf Elitenbildung ausgerichtet war, einzuleiten. Für die französische Besatzungszone wurde das Ziel der Entnazifizierung außer Acht gelassen, aber die Anordnungen in den Schulen waren umso klarer, durchdachter und zielstrebiger. Schließlich wurde die Schulverwaltung Deutschland wieder übergeben, während Frankreich diese noch streng kontrollierte, da sie mehr über die deutsche Kultur wussten, als die USA und konnten daher eine Schulreform wesentlich präziser durchführen. Der Versuch der Verlängerung der Grundschulzeit schlug fehl genauso wie bei Großbritannien und der USA (vgl. Hearnden, 1973, S. 20- 21).
[...]