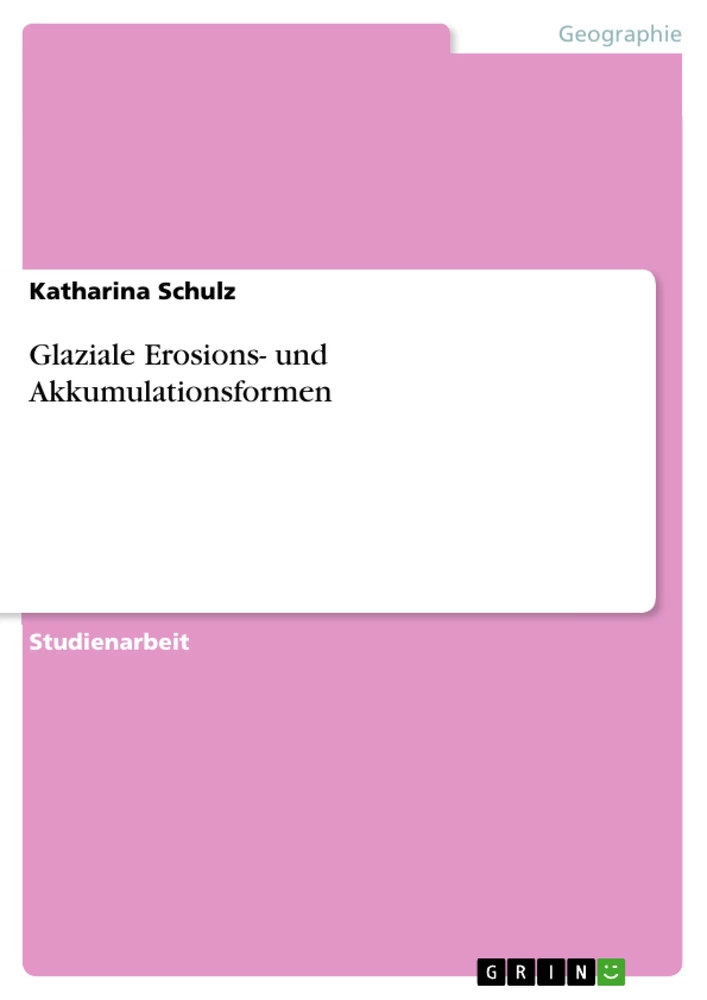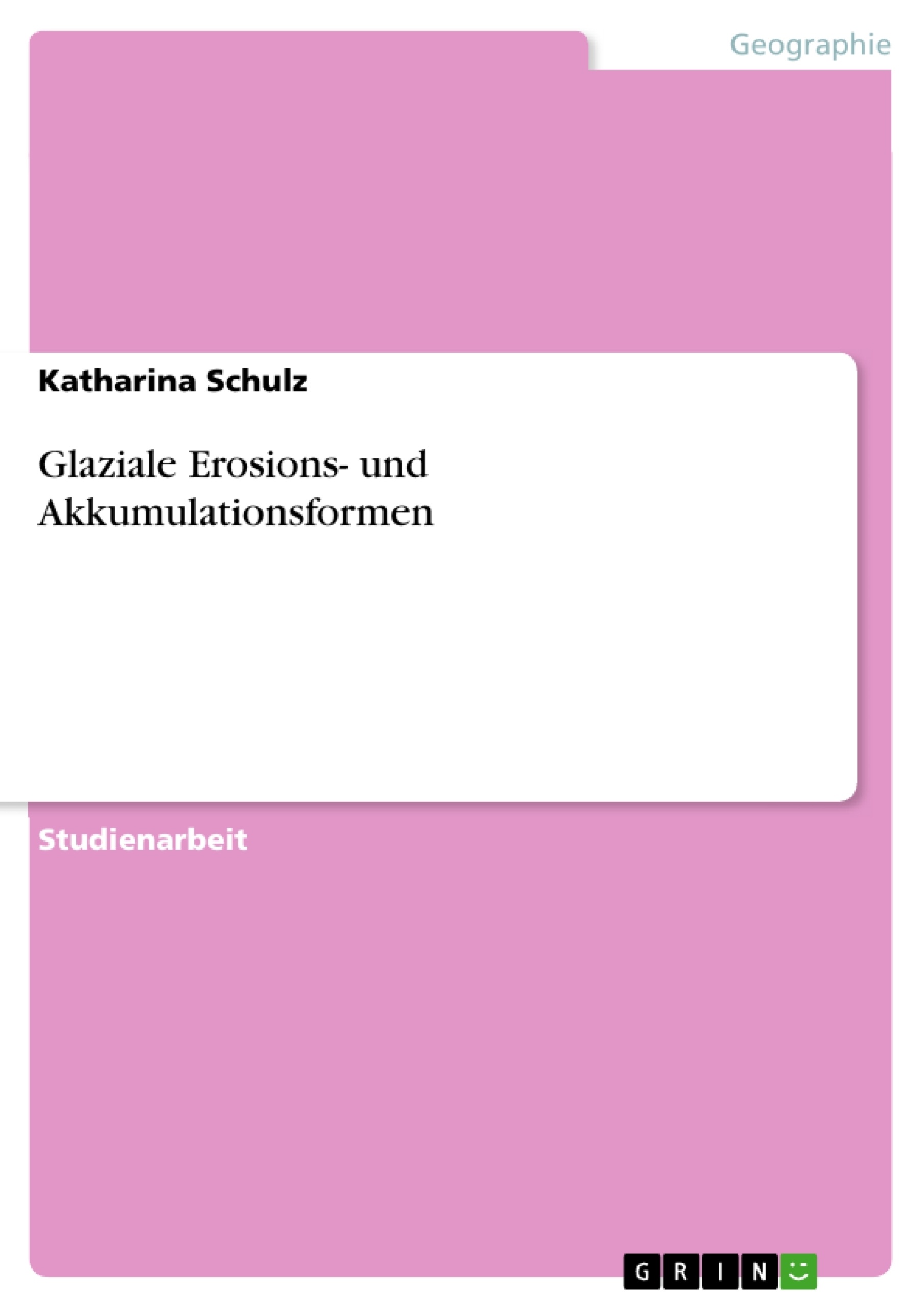Glaziale Erosions- und Akkumulationsformen prägen einen großen Teil der heutigen Erdoberfläche. Ein Grund dafür sind zum einen die in der Erdgeschichte immer wieder auftretenden Eiszeiten und zum anderen die enorm ausgeprägte oberflächenformende Wirkung des Gletschereises. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuell fortschreitenden Klimaerwärmung und dem damit einhergehenden Gletscherrückzug ist davon auszugehen, dass der Anteil der glazial geprägten Erdoberfläche zunehmen wird.
Die Voraussetzungen, die Entstehungsmechanismen sowie die Ausbildungsformen glazialer Erosions- und Akkumulationsformen sind das Thema der vorliegenden Arbeit, genauso wie deren Einbindung in den gesamten formschaffenden Kreislauf der Erdoberfläche.
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, die sich aus Begriffserklärung und Abgrenzung zusammensetzt, wird zunächst auf die Gletscherbewegung eingegangen, da diese als Grundvoraussetzung für das Auftreten glazialer Erscheinungsformen angesehen werden kann. Anschließend werden, nach der Einbindung des Themas in den gesamten oberflächenformenden „Kreislauf der Gesteine“, die einzelnen glazialen Erscheinungsformen und die dazugehörigen Prozesse in chronologischer Reihenfolge näher erläutert.
Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit sowie zugunsten der Verständlichkeit beziehe ich mich bei der Ausarbeitung dieser Kapitel ausschließlich auf die Gletscher des alpinen Raumes. Weiterhin werden – abgesehen vom letzten Kapitel – nur glaziale Oberflächenformen behandelt.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der glazialen Serie – und zwar im Speziellen – mit seiner Anwendung im alpinen Vorland, da die vorhergehenden Kapitel dieser Arbeit ebenfalls auf die Gletschertypen dieses Raumes beschränkt sind. Angesichts der festen Bestandteile dieses Konzeptes werden hier zum Teil auch glazifluviale Oberflächenformen besprochen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 „Glazial“ - Bedeutung und Abgrenzung
3 Gletscherbewegung
4 Glaziale morphodynamische Wirkungskette
4.1 Glaziale Erosionsprozesse und formen.
4.1.1 Kar
4.1.2 Trogtal
4.1.3 Rundhöcker
4.2 Glazialer Transport
4.3 Glaziale Akkumulationsprozesse und formen
4.3.1 Moräne
4.3.2 Toteishohlform
4.3.3 Drumlin
5 Glaziale Serie im Alpenraum
6 Fazit
Literaturverzeichnis