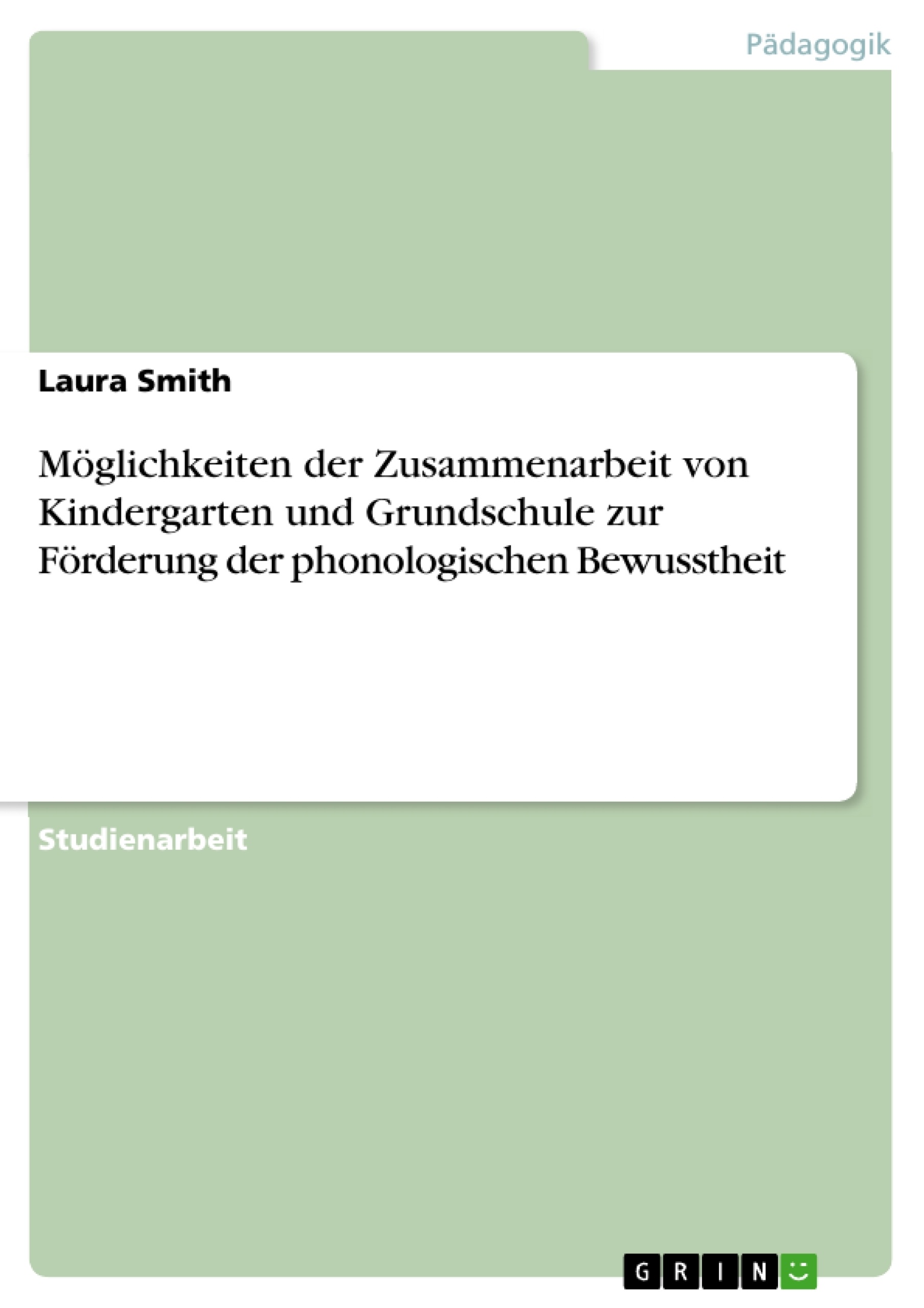Der Gedanke von einer engeren Verzahnung vom Anfangsunterricht in der Grundschule und der Vorbereitung darauf durch den Kindergarten mag als relativ aktuelles Thema der letzten 20 Jahre erscheinen. Doch bereits Comenius plädierte für einen Bildungsbegriff, bei dem das Lernen stufenweise aufeinander aufbaut und kontinuierlich fortschreitet.
Zuerst muss die Frage geklärt werden, ob es sich bei der phonologischen Bewusstheit um eine Voraussetzung des erfolgreichen Schriftspracherwerbs handle, oder um dessen Folge. Korrelative Längsschnittstudien der Oxforder Gruppe um Bradley und Bryant oder der Salzburger Gruppe u.a. belegen, dass eine ausgeprägte phonologische Bewusstheit den Schriftspracherwerb erleichtert.
Einsiedler plädiert daher für vorschulische Trainings der phonologischen Bewusstheit, weil er diese als „eine Schlüsselkompetenz für das Lesenlernen“ bezeichnet. Die dänischen Forscher Lundberg und Peterson haben die These zur Trainierbarkeit der phonologischen Bewusstheit empirisch gesichert, indem sie Trainings zur phonologischen Bewusstheit in einem Kindergarten durchführten und dann die Rechtschreibleistungen dieser Kinder im zweiten Schuljahr prüften. Die Testergebnisse fielen besser aus als bei einer Vergleichsgruppe, deren phonologische Bewusstheit zwar diagnostiziert wurde, jedoch nicht gefördert wurde.
Es hat sich nun gezeigt, dass die Lese- und Rechtschreibfertigkeit maßgeblich durch Fördermaßnahmen zur phonologischen Bewusstheit positiv beeinflusst werden. Weiter wurde gezeigt, dass diese bereits im Vorschulalter notwendig ist. Nun stellt sich die Frage: Wie können Kindergarten und Grundschule zusammenarbeiten, um die phonologische Bewusstheit der Schulanfänger zu fördern?
Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule zur Förderung der phonologischen Bewusstheit
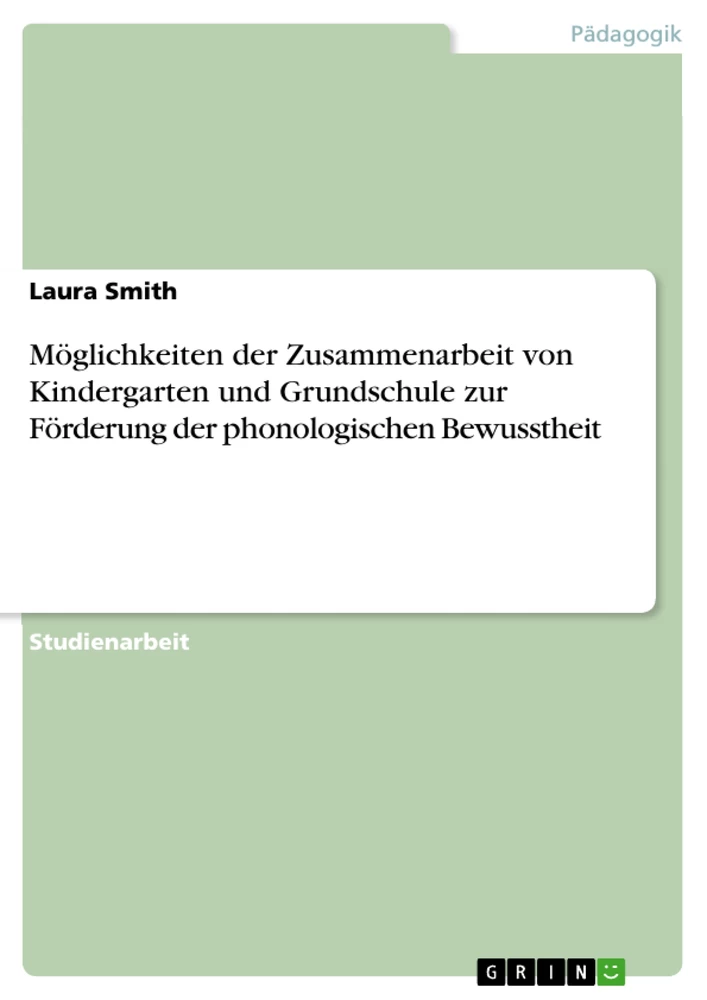
Seminararbeit , 2015 , 7 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Laura Smith (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch