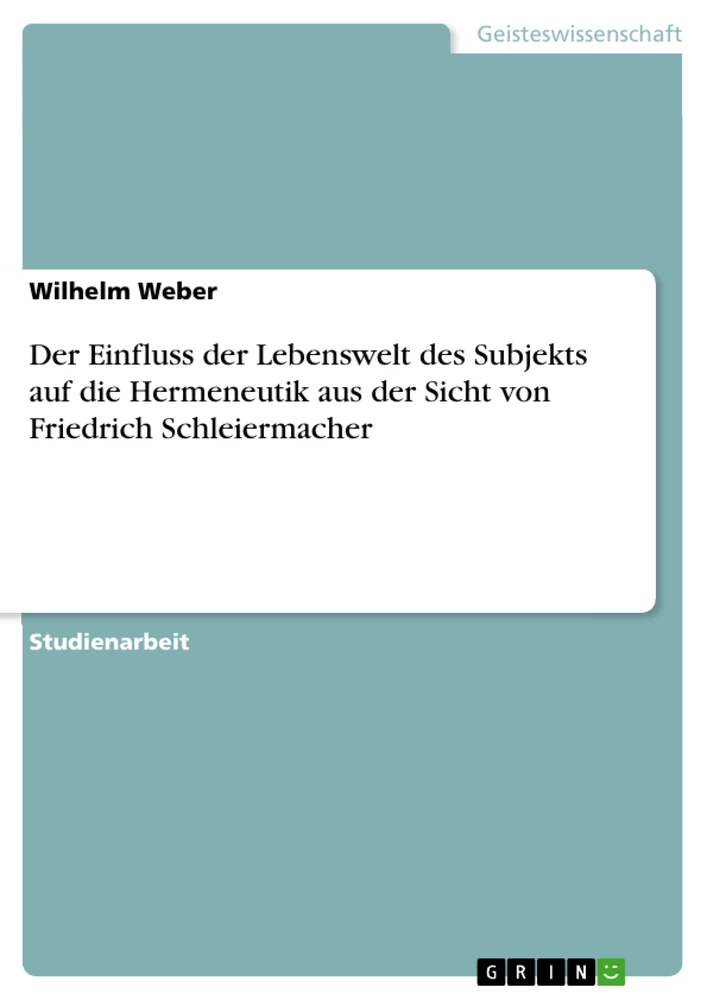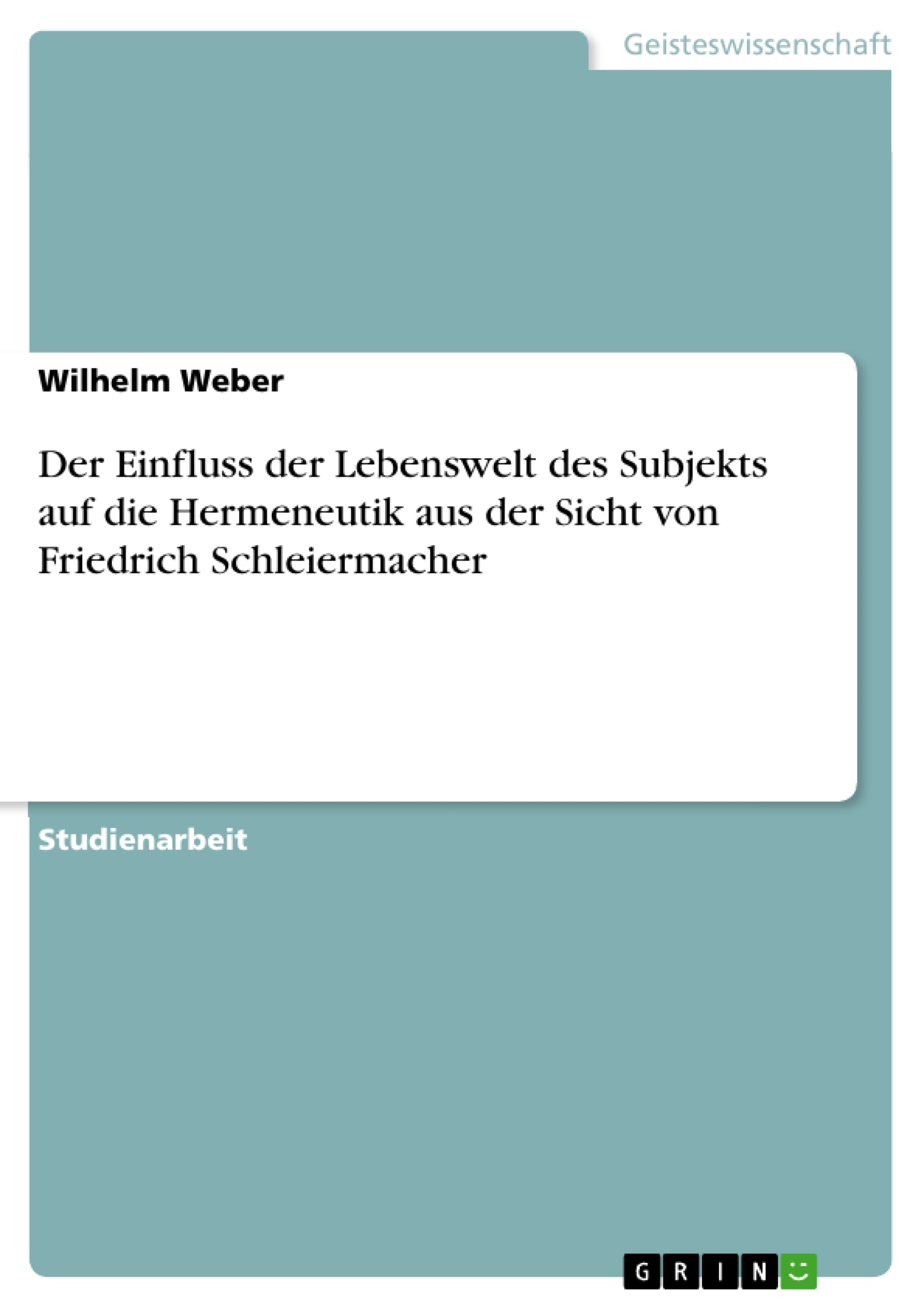Die Seminararbeit befasst sich näher mit der Auffassung von Hermeneutik aus der Perspektive Schleiermachers. Schleiermacher leistete einen nicht unerheblichen Beitrag sowohl zum Verständnis als auch zur Anwendung der Hermeneutik. Besonders widmete Schleiermacher sich dem Einfluss der Subjektivität sowie des persönlichen und kulturellen Umfeldes auf das Verstehen sowohl von Texten als auch mündlichen Mitteilungen.
Genau dieser Schwerpunkt ist der Kern der erkenntnisleitenden Frage, inwiefern die Subjektivität Einfluss auf das Verstehen von Texten sowie Mitteilungen aller Art hat. Die Hermeneutik befindet sich nämlich in einem Spannungsfeld zwischen der Intention des Kommunikators und dem subjektiven Verstehen des Rezipienten. Wie es schon aus dem Anfangsteil der Seminararbeit ersichtlich wird, wird das subjektive Verstehen des Rezipienten im Mittelpunkt stehen. Daraus ergibt sich die Frage, ob es ein von Subjektivität unabhängiges Verstehen gibt oder, ob das Verstehen stets der Subjektivität des Rezipienten unterworfen ist. Die Beantwortung der besagten Frage mit Einbeziehung des lebensweltlichen Kontextes ist daher die zentrale Aufgabe dieser Seminararbeit sein.
Im Zentrum der Hermeneutik steht das Verstehen. Das Verstehen ist ein wesentlicher Bestandteil in Kommunikationsprozessen, besonders in Bezug auf den Rezipienten. Der Rezipient befindet sich innerhalb des Kommunikationsprozesses in einer empfangenden Funktion. Sobald die an den Rezipienten gerichtete Botschaft bzw. Mitteilung klar und deutlich wird, ist vom Verstehen die Rede. Das Verstehen ist folglich als solide Basis für einen gelingenden Kommunikationsprozess anzusehen. Daran ist nämlich zu erkennen, dass die Botschaft den Rezipienten erreicht hat und von ihm erfasst wurde.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Hermeneutik als Kunst des Verstehens
2. Themenschwerpunkte und Vorgehensweise
3. Die Hermeneutik bei Schleiermacher
3.1 Schleiermachers Hermeneutik im Allgemeinen
3.2 Die Subjektivität und deren Einfluss in Hinblick auf die Hermeneutik
3.3 Die Wechselbeziehung vom Verstehen schriftlicher Werke und Subjektivität
4. Die Subjektivität aus heutiger Sicht
5. Fazit zum Einfluss der Lebenswelt des Subjektes auf die Hermeneutik
6. Subjektivität und lebensweltlicher Kontext angesichts der Hermeneutik
7. Persönliche Stellungnahme zum lebensweltlichen Kontext des Subjektes angesichts der Hermeneutik
8. Literaturverzeichnis