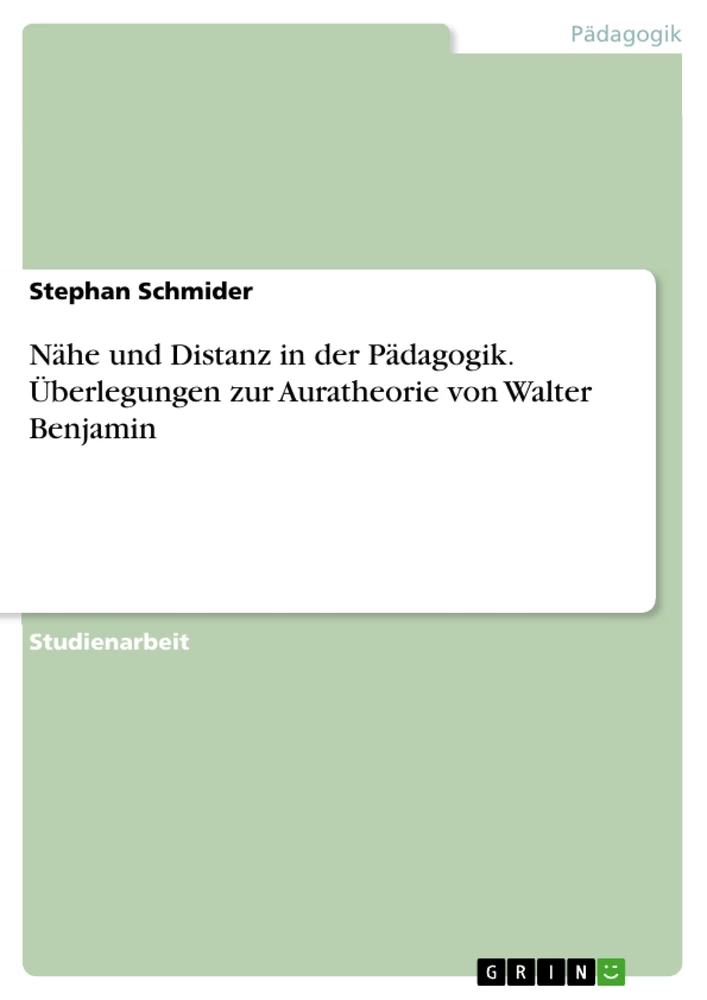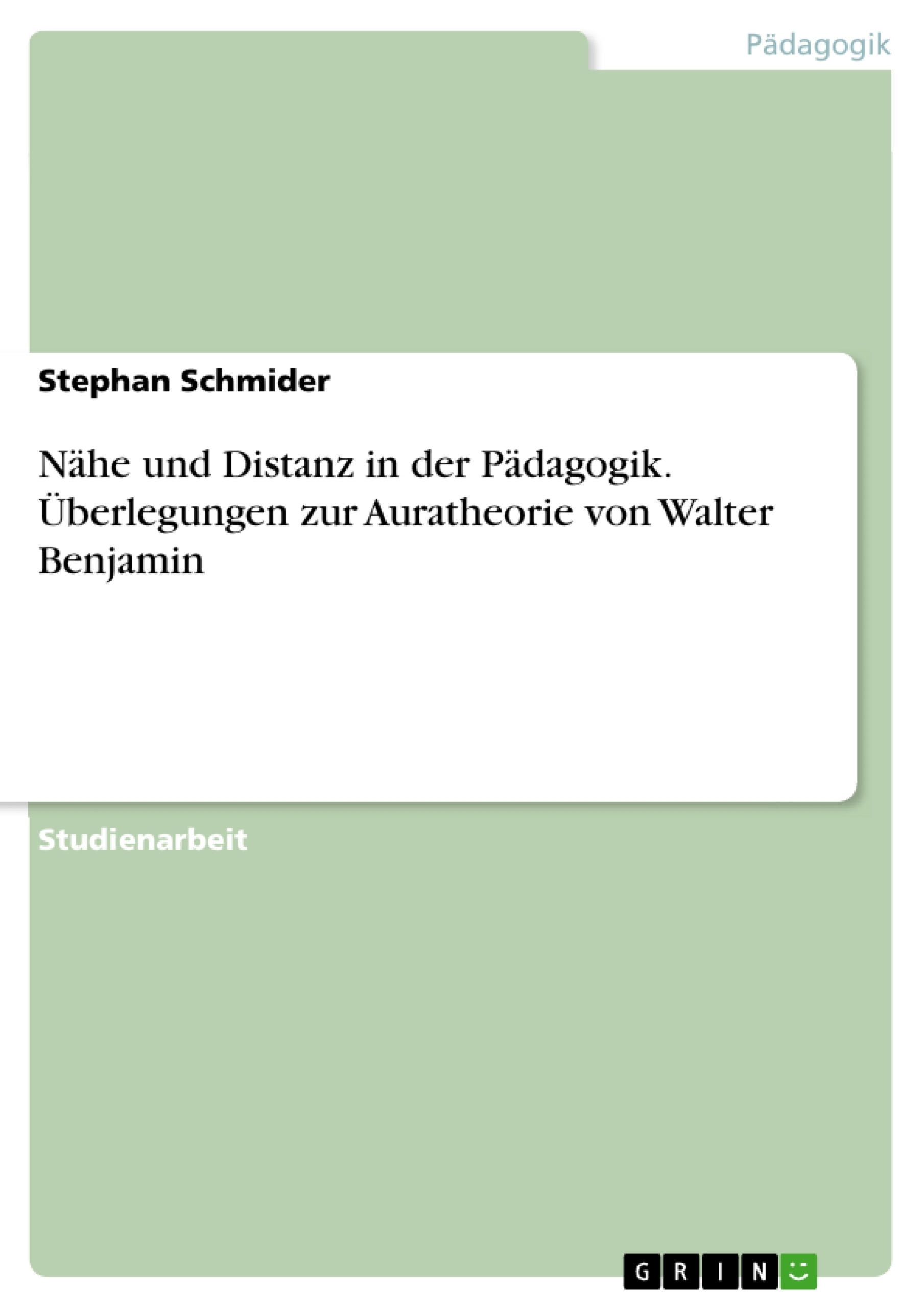Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Nähe-Distanz Problem der Pädagogik. Mit Hilfe von Walter Benjamins Medientheorie wird gezeigt, dass es sich hierbei um ein Grundproblem der Pädagogik handelt. Benjamins These vom Verlust der Aura des Kunstwerkes durch Reproduktionstechniken wird erweitert, indem gezeigt wird, dass der Verlust nicht an der Technik der Reproduktion haften muss, sondern in Denksystemen der Pädagogik selbst verankert liegt.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst erklärt, was Nähe, Distanz und Professionalität miteinander zu tun haben und was für problematische Folgen einer Nicht-Balance von Nähe und Distanz entstehen können. Im zweiten Teil wird dann stärker auf Walter Benjamins Text „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ eingegangen. Das Essay wird inhaltlich kurz umrissen und es wird erklärt, welche Veränderungen durch die technische Reproduzierbarkeit in der Moderne entstanden sind. Fokussiert wird hierbei der Auraverlust, denn dieser charakterisiert Merkmale, die das Nähe-Distanz Problem der Pädagogen betreffen.
Es wird die These vertreten, dass der Auraverlust nicht nur in Medien der Technik stattfindet, sondern in Konzepten und Denksystemen der Pädagogik selbst verankert liegt. Hierdurch wird erklärt warum pädagogische Beziehungen häufig zu belastend für die Professionellen wirken können. Im letzten Teil der Arbeit wird daher auf Präventionsstrategien zurückgegriffen, die sich positiv auf das Grundproblem der Pädagogen auswirken. Es werden Techniken der Achtsamkeit, die seit Jahrtausenden von Menschen angewandt werden, vorgestellt.
Inhalt
1. Einführung
2. Das Nähe- Distanz Problem in der Pädagogik
2.1. Nähe, Distanz und Professionalität
2.2 Zu viel Nähe – Burnout und problematische Folgen eines pädagogischen Grundproblems
3. Die Moderne und der Verlust der Aura bei Walter Benjamin
3.1 Auraverlust und Reproduktion
3.2 Auraverlust, Allmacht und Pädagogik
4. Prävention – Achtsamkeitspädagogik
4.1 Meditation und Entspannung – Gegenpol zu Hektik und Stress
4.2. Achtsamkeit – absichtsloses Leben im Hier und Jetzt
Abschluss
Literatur: