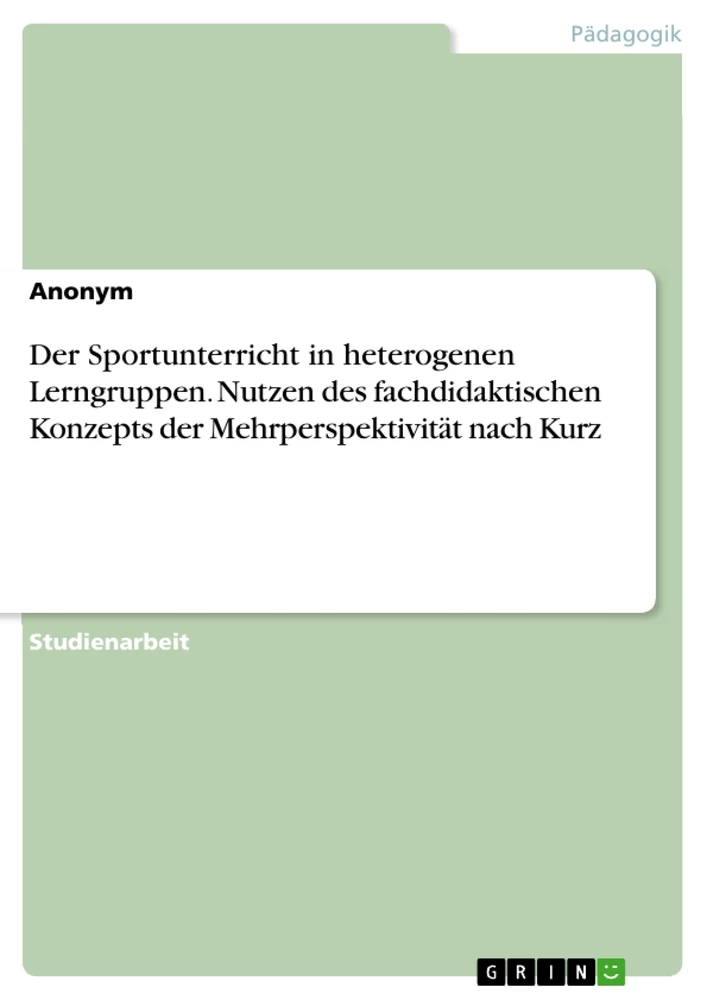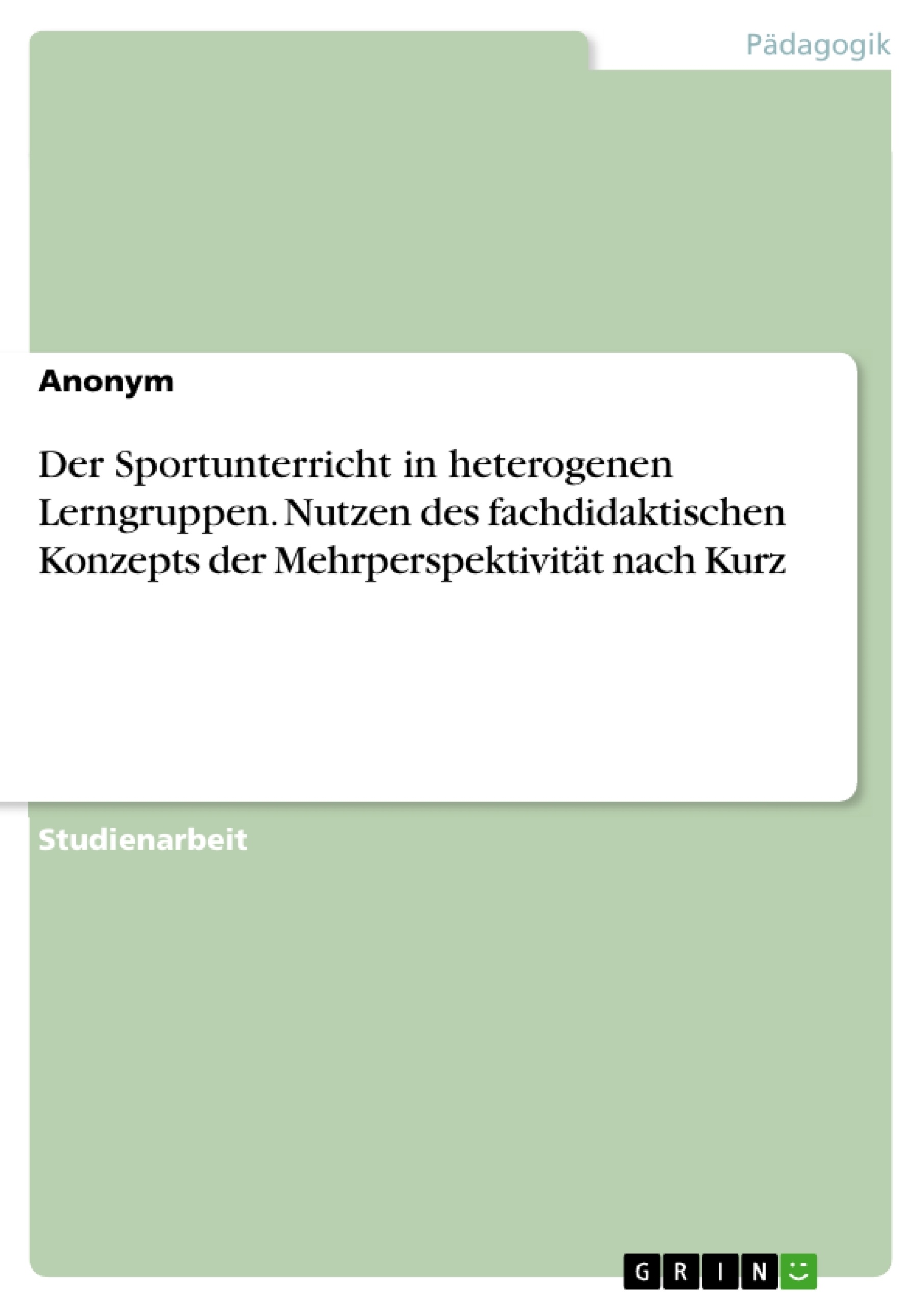Im Rahmen des Seminars „Sport in heterogenen Lerngruppen“ soll in der vorliegenden Arbeit der Fragestellung nachgegangen werden, inwiefern das fachdidaktische Konzept der Mehrperspektivität von Kurz eine Orientierung für den Sportunterricht in heterogenen Lerngruppen bietet.
Es gibt zahlreiche unterschiedliche didaktische Konzepte für den Sportunterricht, die sich in Fokus und – teilweise kontroversen – Leitgedanken unterscheiden. Das Konzept von Kurz beschäftigt sich mit der Mehrperspektivität des Sportunterrichtes. Dazu wurden sechs Perspektiven herausgearbeitet – Leistung, Miteinander, Eindruck, Ausdruck, Wagnis und Gesundheit. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dieser Kategorien können im Sportunterricht realisiert werden und diesen insbesondere in heterogenen Gruppen unterstützen, deren Mitglieder unterschiedliche Voraussetzungen und Motivdispositionen mitbringen. Beispielsweise können innerhalb einer Gruppe individuelle Unterschiede im Bereich der Leistung, Gesundheit, Interessen, Körperbau etc. vorhanden sein, auf die die Lehrkraft eingehen sollte, will sie sich jedem Gruppenmitglied optimal annehmen.
Ob das Konzept der Mehrperspektivität unter diesen Voraussetzungen eine Orientierung für den Sportunterricht in heterogenen Lerngruppen bieten kann, soll im Folgenden diskutiert werden. Dazu wird zunächst der Begriff Heterogenität beziehungsweise heterogene Lerngruppen im schulischen Kontext erläutert. Das fachdidaktische Konzept von Kurz wird ausführlich beschrieben, um derart eine Grundlage für die Beantwortung der eingangs erwähnten Forschungsfrage zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffserklärung heterogene Lerngruppen
3. Das fachdidaktische Konzept von Kurz
3.1 Grundgedanken des mehrperspektivischen Vermittlungsansatzes von Kurz:
3.2 Pädagogische Perspektiven bezogen auf den Sport in heterogenen Lerngruppen
3.2.1 Leistung
3.2.2 Miteinander
3.2.3 Wagnis
3.2.4 Gesundheit
3.2.5 Eindruck
3.2.6 Ausdruck
4. Ausblick
Literaturverzeichnis