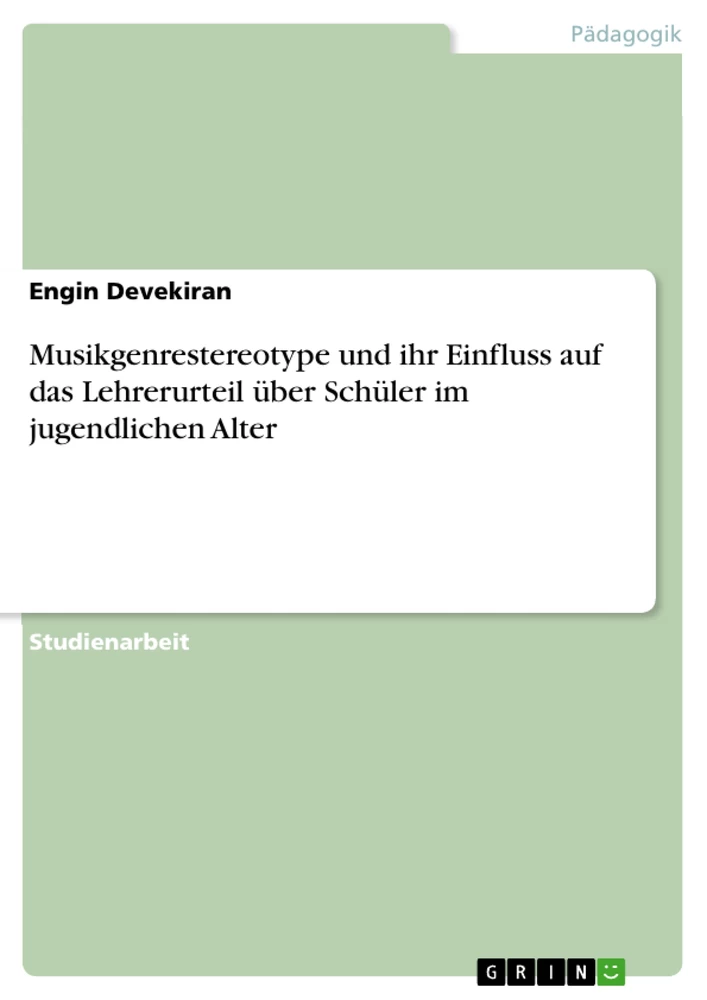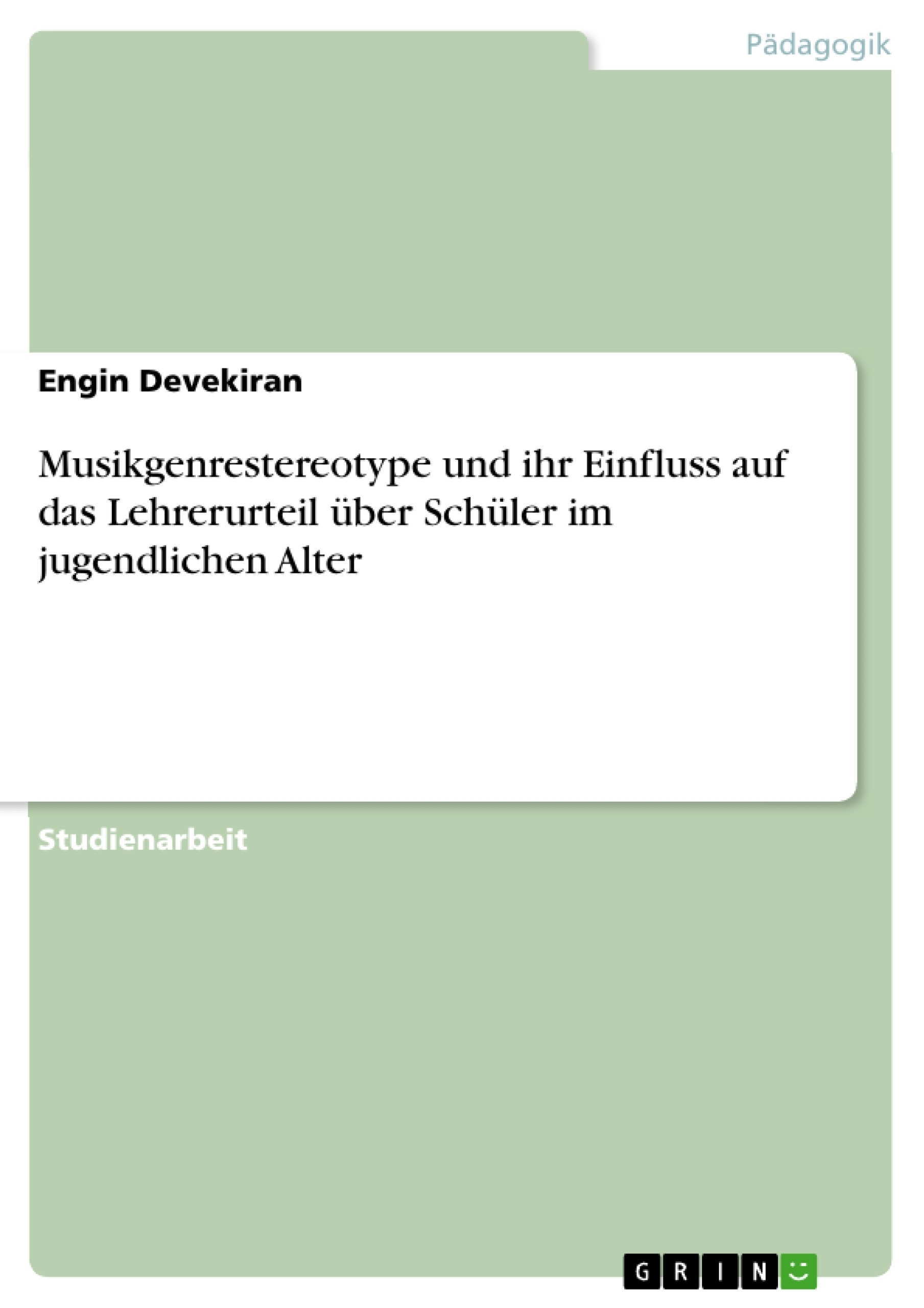In diesem Paper wird die These vertreten, dass Schülern, die Anhänger bestimmter Musikrichtungen sind, Eigenschaften zugeschrieben werden, die der Lehrer mit der von ihnen gehörten Musik assoziiert. Es wird behauptet, dass dies das Lehrerurteil beeinflusst.
Man erkennt sie schon von weitem. Schwarze Stiefel, schwarze Jeans, schwarze Lederjacken, T-Shirts bedruckt mit Gewaltmotiven und okkulter Symbolik und dann noch die langen Haare. Fragt man andere Menschen nach der präferierten Musikrichtung von Personen mit solch einem Kleidungsstil, werden sie diese relativ mühelos als Fans der Musikrichtung Heavy Metal identifizieren können. Genauso leicht fällt es, bei Menschen (in diesem Fall vor allem Männer) mit tiefsitzenden Jeans und sehr weiten, langen T-Shirts von einem Hip Hop- oder Rap-Hörer zu sprechen.
Allein schon durch ihr Äußeres werden diese Personen von anderen Menschen sozialen Gruppen zugeordnet. Je nach Situation und Kontext befindet sich ein Mensch in verschiedenen sozialen Gruppen (z.B. im Ausland zugehörig zur Gruppe „Tourist“, zu Hause ein „Student“). Soziale Gruppen teilen gemeinsame Charakteristiken, die soziale Bedeutung für sie und/oder für andere haben. Der Vorgang, der die soziale Gruppenbildung bestimmt, heißt soziale Kategorisierung. Damit ist der Prozess der Identifizierung von Individuen als Mitglieder einer bestimmten Gruppe gemeint.
Dies erfolgt aufgrund der Tatsache, dass sie Merkmale aufweisen, die typisch für die jeweilige Gruppe sind. Das geschieht sehr schnell und automatisch. Stereotype sind eben diese Zuschreibungen, die sowohl positiver als auch negativer Art sein können. Manche Stereotype beschreiben existierende Unterschiede zwischen Gruppen, dabei werden diese Unterschiede aber übertrieben dargestellt. Andere Stereotype sind hingegen nicht zutreffend. Stereotype werden gebildet durch Interaktion mit sozialen Gruppen, oder durch Erzählungen anderer Menschen über diese Gruppe (Smith & Mackie, 2000).
Inhalt
Einleitung
Herleitung der These
Stereotypenforschung und zero acquaintance – Studien
Forschung zu Vorhersagekraft des Musikgeschmacks und Musikgenrestereotype
Bedeutung der Musik im Jugendalter
Stereotype im Schulkontext
Musikgenrestereotype im Schulkontext
Methode der Untersuchung
Studie 1
Studie 2
Literaturverzeichnis