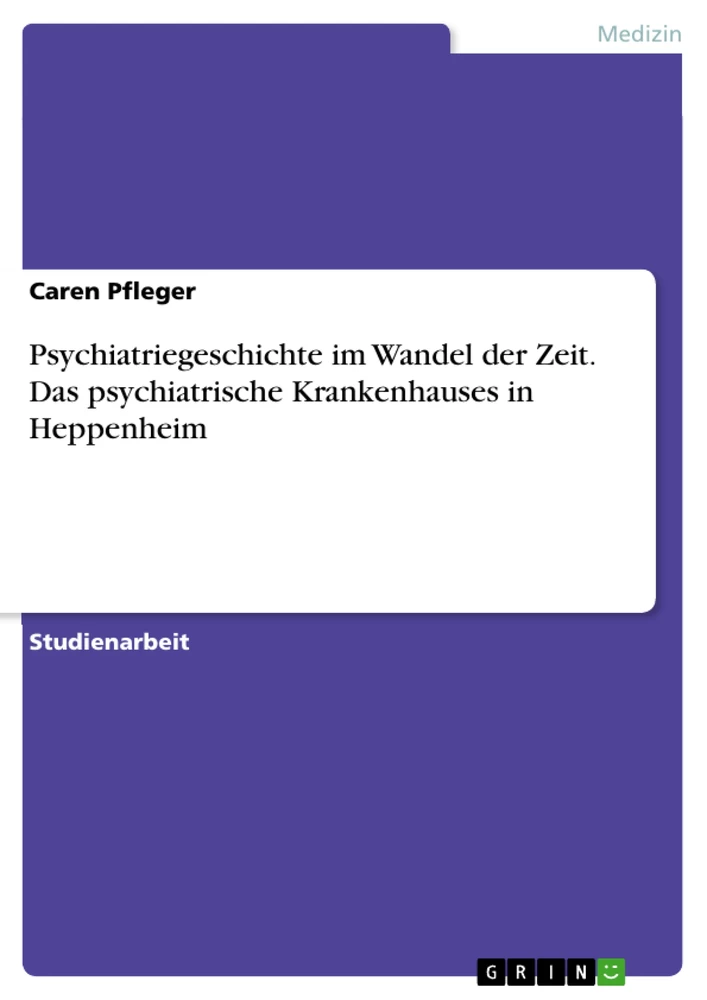Ich möchte diese Ausarbeitung mit der Vorstellung über Psychiatrie in der frühen bürgerlichen Gesellschaft beginnen. Einleitend werde ich hierbei einen kurzen Abriss der historischen Entwicklung vor dieser Epoche erläutern, um im Anschluss die weitere Phasen aufzeigen zu können. Ich werde hierbei das damalige Verständnis über Geisteskrankheiten erläutern und den Umgang mit Betroffenen in damaligen Gesellschaft darlegen. Um den Rahmen dieser Ausarbeitung nicht zu sprengen, werde ich die unterschiedlichen Geisteskrankheiten dieser Zeitepoche und ihre Formen und Merkmale allerdings nicht beschreiben, sondern mich lediglich auf die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und dem Umgang mit dieser Personengruppe konzentrieren.
Seelische Störungen sind heutzutage eine der häufigsten Erkrankungen der Menschheit. Folgt man der deutschen Techniker Krankenkasse, so litten im Jahr 2013 fünf Prozent der Versicherten an psychischen Erkrankungen und Störungen. Die Fehlzeiten der Versicherten sind in den Jahren 2000 bis 2013 um 69 Prozent gestiegen und eine Besserung ist bisher nicht in Sicht. Auch in der Vergangenheit waren viele Menschen von physischen Erkrankungen betroffen. Falls man diese Menschen überhaupt behandelte, dann mit fragwürdigen Mitteln. Gang und gäbe war es, die Irren einfach aus der Gesellschaft herauszunehmen und sie in dementsprechende Einrichtungen unterzubringen, um sie dort meist verwahrlosen zu lassen.
Die Geschichte der Psychiatrie ist mehr als jede andere medizinische Disziplin in der Menschheit abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Einstellungen. Aus heutiger Sicht stößt der Umgang mit geisteskranken Menschen im Laufe der Zeit auf eine große Absonderlichkeit der damaligen Weltbilder und deren Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen.
Es stellt sich im Kontext der zuvor erläuterten Problematik die Frage, inwieweit und durch welche Einflüsse sich der Umgang mit geisteskranken Menschen im Laufe der Geschichte zum heutigen Standard entwickelte. Warum kam es zu Großinstitutionen, in denen Geisteskranke mehr verwahrt als aktiv therapeutisch gefördert wurden, und mit welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen stand diese Verachtung in Bezug auf psychisch Kranke und behinderte Menschen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Psychiatrie in der frühen bürgerlichen Gesellschaft
2.1. Ideengeschichtliche Leitideen im Zeitalter des Umbruchs
2.2. Die Ära der Anstaltsgründungen und deren Philosophie
3. Das psychiatrische Krankenhaus in Heppenheim
3.1. Georg Ludwig und die Gründung der Großherzoglichen Landes-Irrenanstalt in Heppenheim
3.2. Die Landesirrenanstalt als Heil und Pflegeanstalt
3.3. Die Krisenzeiten 1914-1945
3.4. Von der Krise zur Katastrophe
3.5. Der Weg zum modernen Krankenhaus
4. Fazit
Literaturverzeichnis