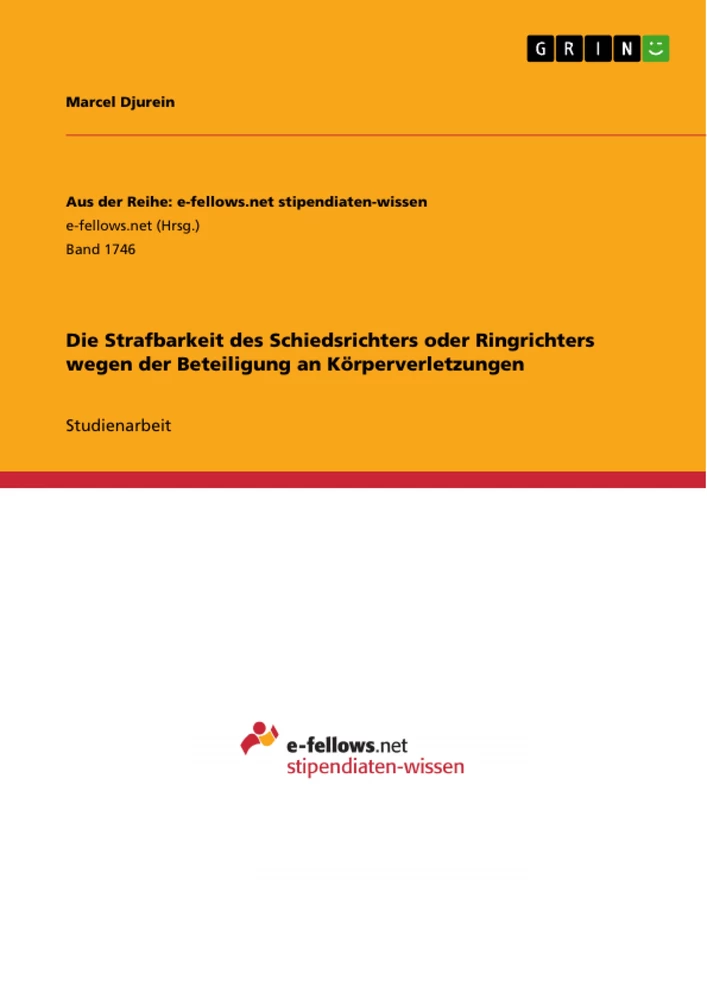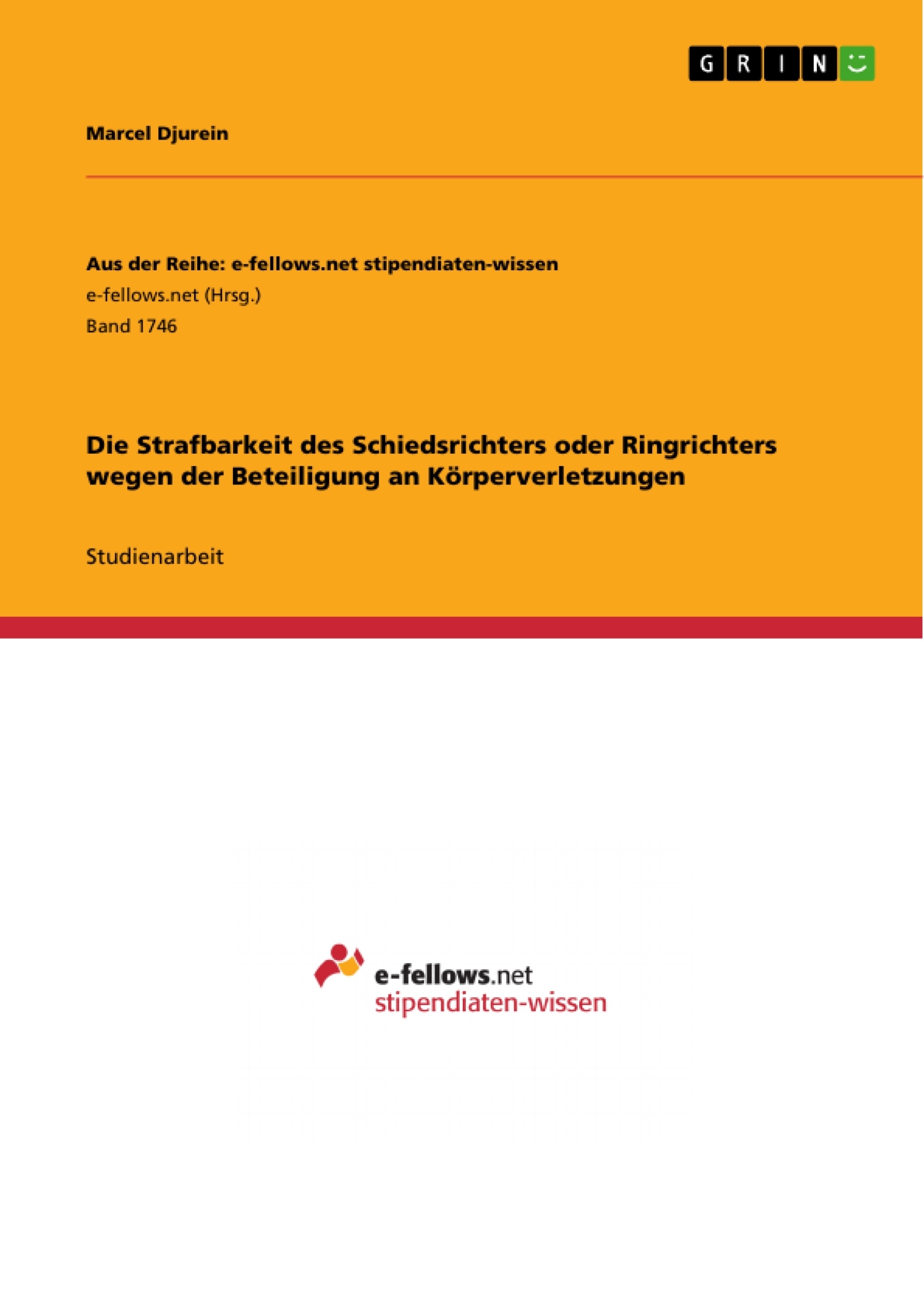Gegenstand der Arbeit soll die Frage sein, ob und gegebenenfalls wie sich ein Schiedsrichter wegen der Beteiligung an Körperverletzungen strafbar machen kann und ob ihm eventuell Strafbarkeitserleichterungen zu Gute kommen. Dabei soll auch sein Pendant im Kampfsport, der Ringrichter, in die Betrachtung eingeschlossen werden.
Sport nimmt in unserer heutigen Gesellschaft eine zentrale Rolle ein. Großereignisse wie die Olympischen Spiele in Sotschi oder die FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Brasilien ziehen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Professionelle Sportler einiger Sportarten gehören zu den bestbezahlten und bekanntesten Personen ihrer Zeit. Wenig Beachtung findet dagegen eine Personengruppe, die diese Art von Wettkämpfen überhaupt erst ermöglicht: Die Schiedsrichter.
Fast schon spiegelbildlich ist der Schiedsrichter auch in der juristischen Literatur eine Randerscheinung. Während die mögliche Straffreistellung von Spielern bei der Sportausübung zu einem vieldiskutierten Thema in der Rechtswissenschaft zählt, ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Schiedsrichters noch kaum näher beleuchtet worden.
Dabei bietet vor allem die kürzlich zu Ende gegangene Fußballweltmeisterschaft durchaus Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So wurde im Viertelfinalspiel zwischen Brasilien und Kolumbien der brasilianische Spieler Neymar durch eine Attacke eines kolumbianischen Gegenspielers schwer am Rücken verletzt. Mitursächlich war womöglich die Art der Spielleitung durch den Schiedsrichter, der trotz vieler, zum Teil harter Fouls im Vorfeld kaum zu gelben Karten gegriffen hatte. Hierfür wurde er zwar im Anschluss an die Partie öffentlich gescholten, die Frage nach eventuellen strafrechtlichen Konsequenzen für ihn wurde aber nicht aufgeworfen.
Gliederung
A. Einführung
B. Allgemeines zu Schiedsrichter und Ringrichter
C. Differenzierung nach Sporttypen
I. Sportarten ohne körperlichen Kontakt
II. Sportarten gegeneinander mit regelmäßigem Körperkontakt
III. Sportarten gegeneinander mit Verletzungsziel
D. Strafbarkeit des Schiedsrichters bzw. Ringrichters
I. Körperverletzung durch aktives Tun
1. Vorsätzlich
a) Täterschaft
b) Teilnahme
2. Fahrlässig
II. Körperverletzung durch Unterlassen
1. Vorsätzlich
2. Fahrlässig
a) Durch Entgleitenlassen eines Spiels
b) Durch nicht Herbeirufen eines Arztes
c) Durch Nichtabbruch eines Spiels trotz Gewitters
d) Durch Anpfiff oder Nichtabbruch bei gefährlichem Untergrund
e) Durch Nichtabbruch eines Kampfes trotz Verteidigungsunfähigkeit
f) Durch nicht ausreichende Kontrolle der Ausrüstung
3. Garantenstellung
a) Aus Gesetz
b) Aus freiwilliger Übernahme
aa) Durch Vertrag
bb) Kraft faktischer Übernahme
c) Aus Ingerenz
d) Zwischenergebnis
E. Ausschluss der Strafbarkeit aufgrund sporttypischer Besonderheiten
I. Möglichkeiten eines Strafbarkeitsausschlusses für Körperverletzungen von Sportlern untereinander
1. Einwilligung
2. Soziale Adäquanz
3. Erlaubtes Risiko
4. Stellungnahme
II. Übertragung auf Schieds- und Ringrichter
1. Vorsätzliche Körperverletzungen
2. Fahrlässige Körperverletzungen
a) Durch aktives Tun
b) Durch Unterlassen
F. Fazit