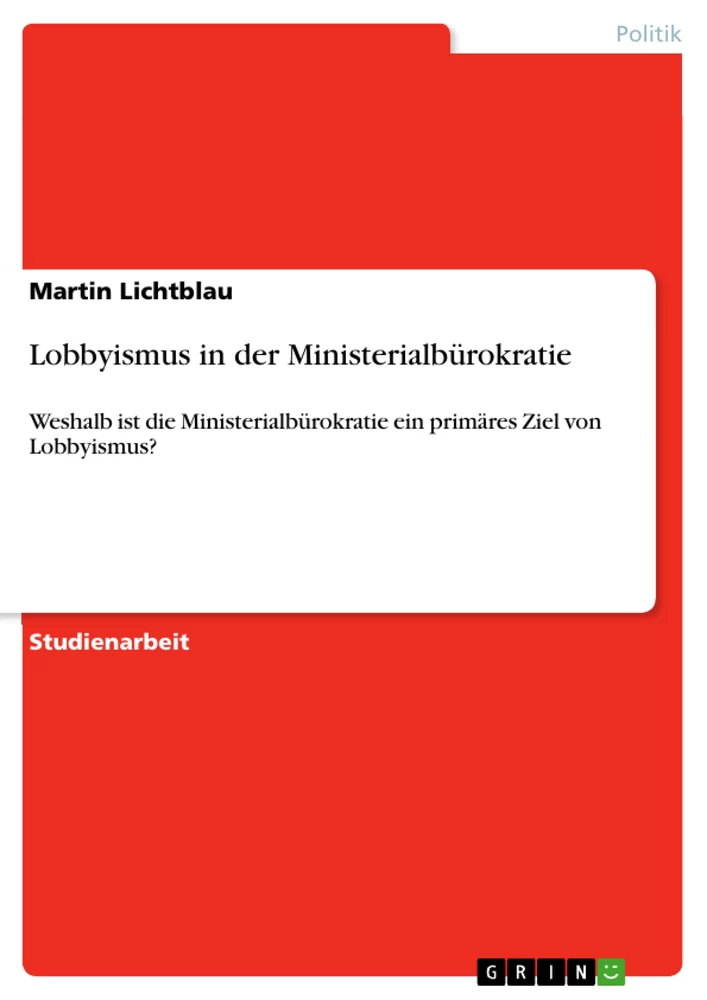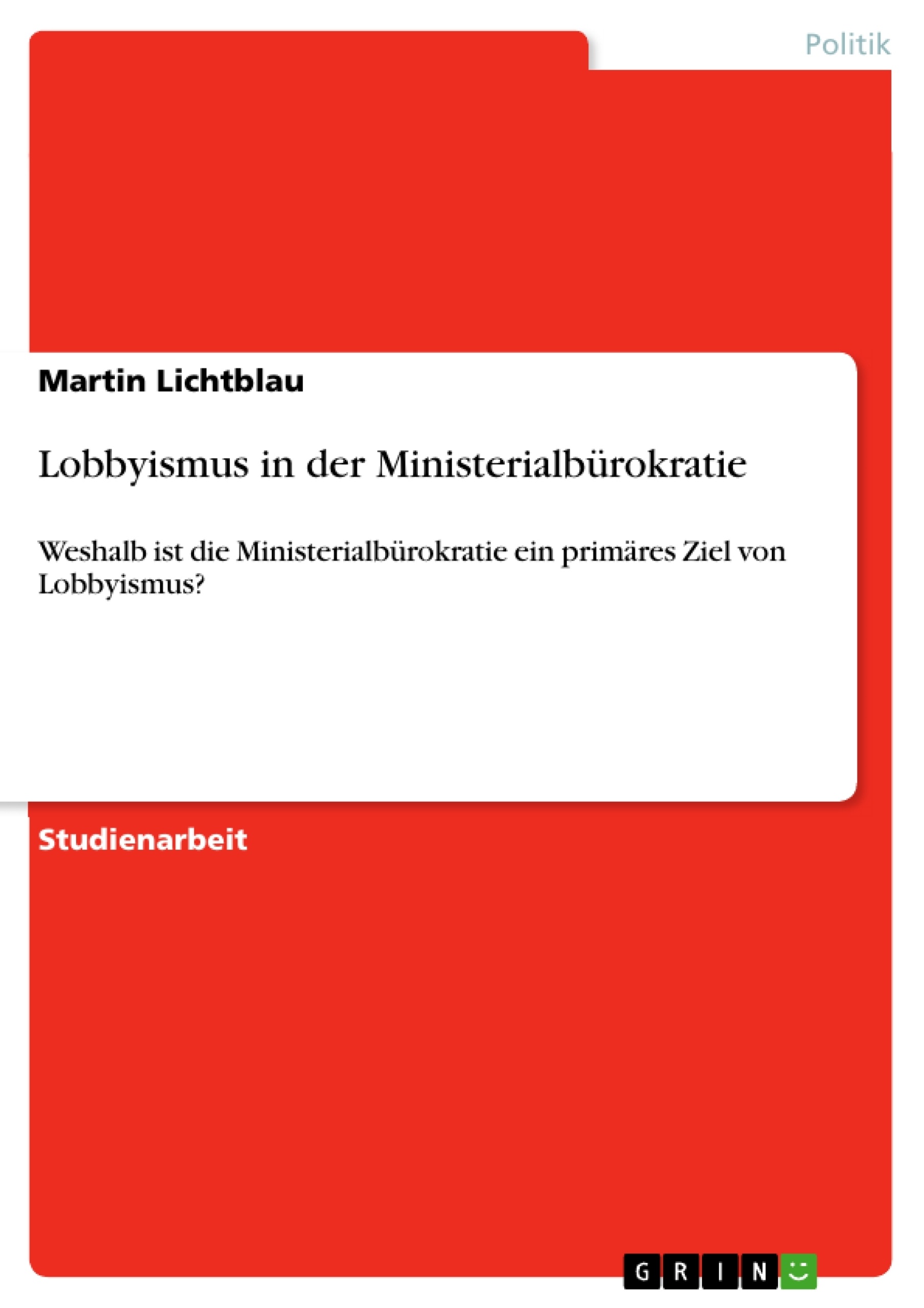Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Themen “Lobbyismus” und“Ministerialbürokratie”, wobei die Ministerialbürokratie die Schnittstelle zwischen Regierung und Verwaltung darstellt. Die zentrale Frage lautet: “Weshalb ist die Ministerialbürokratie das primäre Ziel von Lobbyismus”. Die Antwort soll Gründe liefern, weshalb die Ministerialbürokratie das primäre Ziel von Lobbyismus ist.
Zunächst muss allerdings geklärt werden, ob die Ministerialbürokratie überhaupt nachweislich ein wichtiges Ziel von Lobbyismus ist. Bis dahin stellt die positive Beantwortung die tragende Hypothese dieser Arbeit dar. Einige wissenschaftliche Arbeiten haben diese Hypothese schon untersucht, andere haben die Verbindung der beiden Themenfelder sogar umfassend betrachtet. Jedoch werden meistens nur Lobbyingstrategien untersucht und nicht die verschiedenen Ursachen des Phänomensermittelt. Zudem sind beide ständig im Wandel und immer neue Informationen werden offengelegt. Noch dazu ist die Ministerialbürokratie und ganz besonders der Lobbyismus für Außenstehende in vielerlei Hinsicht intransparent und demnach nur schwer zu untersuchen. Um die Ausgangsfrage trotzdem beantworten zu können, werden verschiedene Strategienkombiniert.
Grundsätzlich werden zu Beginn die zentralen Themen inhaltlich definiert und der Kenntnisstand der Wissenschaft in Hinblick auf die Fragestellung untersucht. Im weiteren Verlauf wird der Untersuchungshorizont der Arbeit spezifiziert. Nämlich auf direktes Lobbying durch die Privatwirtschaft in Form von Interessengruppen, Verbänden und Unternehmen. Die eigentliche Aufgabe besteht darin, die Ziele des Lobbyismus und dessen Auftraggeber zu untersuchen und die Merkmale der Ministerialbürokratie zu definieren, die sie von anderen Adressaten unterscheidet. Anhand von Thesen werden anschließend die Ziele und Merkmale in Verbindung gesetzt. Abschließend wird überprüft, ob diese Verbindung nachweißlich ein Grund ist, dass die Ministerialbürokratie das primäre Ziel von Lobbyismus ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition
2.1. Ministerialbürokratie..
2.2. Lobbyismus
2.3 Lobbyismus Begriffsabgrenzung..
3. Grobe Wegfindung
4. Kenntnisstand der Wissenschaft
4.1 Stellung der Ministerialbürokratie im Lobbyismus..
4.2 Gründe für hervorgehobene Stellung der Ministerialbürokratie
5. Festlegung der Wegfindung..
6. Merkmale und Ziele der drei Akteure im Lobbyismus
6.1 Absender
6.2. Wirtschaftssektor.
6.3 Lobbyist
6.4 Adressat
7. Untersuchung der Thesen
7.1 Langfristige gute Beziehungen
7.2 Früh über Gesetzentwürfe informiert
7.3 Rechtliche Grundlage und staatliche Förderung
7.4 Spielraum bei Gesetzentwürfen und Änderungen
7.5 Fehlender Sachverstand und begrenzte personelle Ressourcen
7.6 Öffentliche Ressourcen in öffentlicher Verwaltung
8. Schlussbetrachtung
9. Literaturverzeichnis.