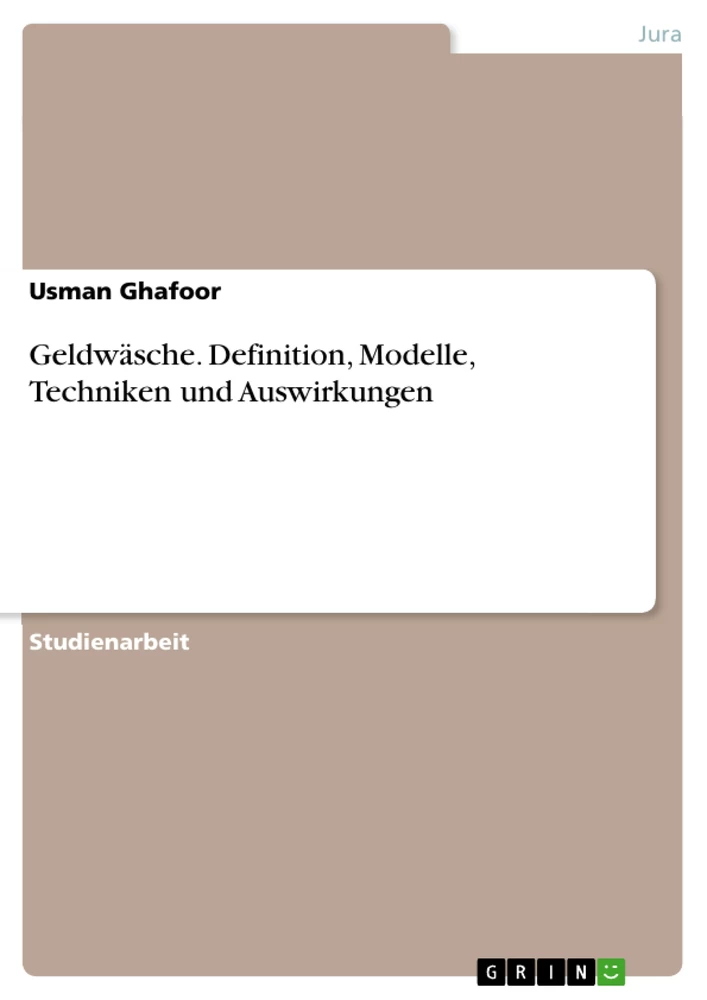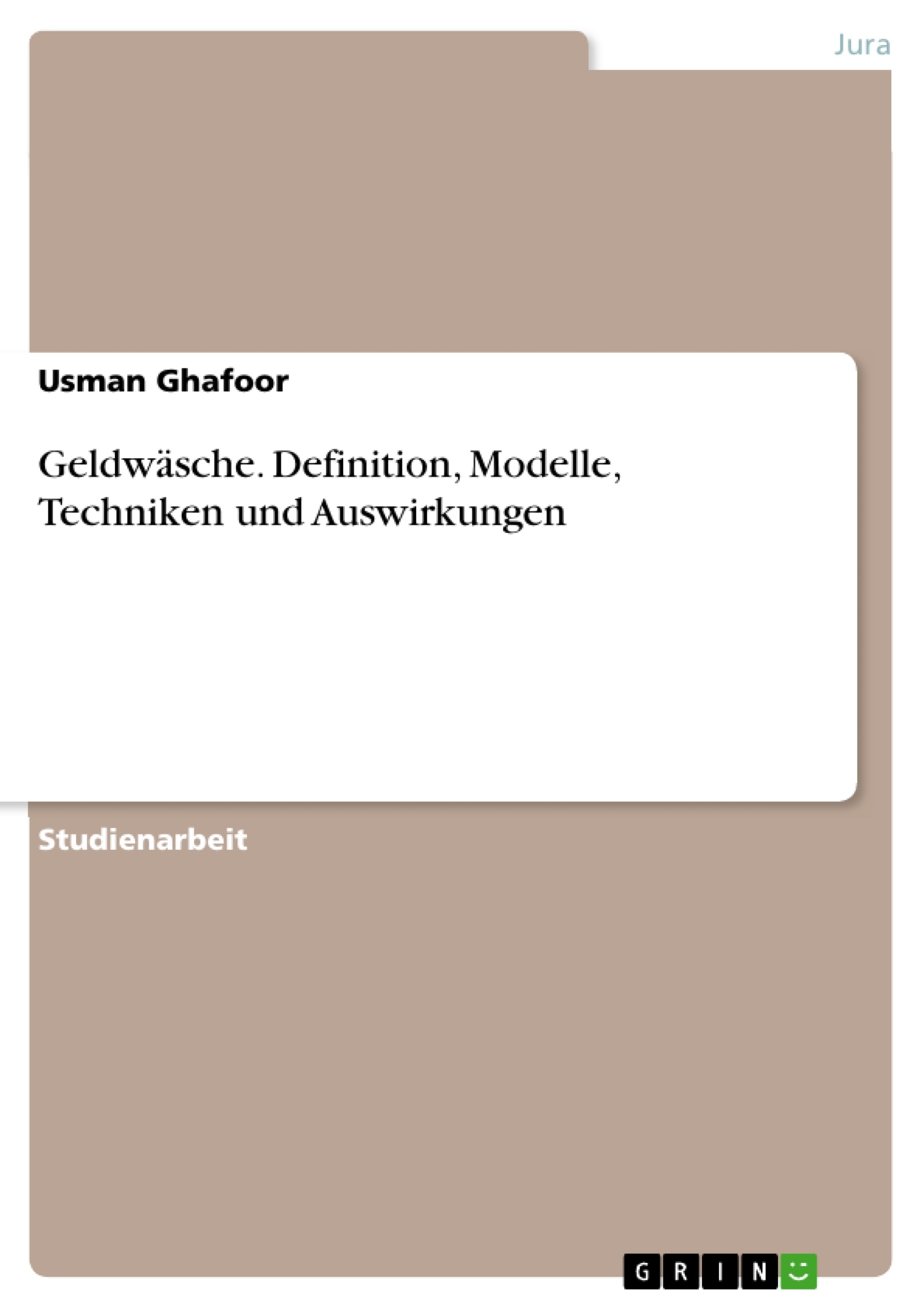Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Thema „Geldwäsche“ näher zu erläutern. Anschließend erfolgt ein Einblick über die Techniken der Geldwäsche. Aufbauend darauf werden im nächsten Abschnitt die Auswirkungen und die Bekämpfung der Geldwäsche aufgezeigt. Abschließend wird es mit einem persönlichen Fazit beurteilt.
Das Bundeskriminalamt in Deutschland beschreibt die Geldwäschebekämpfung wie folgt. „Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf das World Trade Center am 11.09.2001 wurden national und international bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus eine Reihe neuer gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien verabschiedet, die das Betätigungsfeld von Straftätern immer mehr einschränken sollen […]“
In der heutigen Zeit ist Geldwäsche nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern der Welt. Finanzmärkte haben sich zusammengeschlossen und dadurch fällt es enorm schwer, Geldwäsche gezielt zu bekämpfen. Die Methoden der Geldwäsche werden immer komplizierter. Eine Kooperation zwischen allen Ländern ist von hoher Bedeutung.
Immer wieder kann man aus den Medien entnehmen, dass große Unternehmen Geldwäsche betrieben haben. Allein in Deutschland ist die Anzahl der polizeierfassten Fälle der Geldwäsche drastisch gestiegen. In den letzten zehn Jahren sind die Vorfälle um 90 Prozent angewachsen. Die Dunkelziffer im Jahr 2014 lag bei 8.138 Vorfällen. Im Vergleich zu 2004 lagen die Vorfälle bei 776.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bedeutung der Geldwäsche und Definition
3 Modelle und Techniken
3.1 Drei-Phasenmodell
3.1.1 Erste Phase: Placement
3.1.2 Zweite Phase: Layering
3.1.3 Dritte Phase: Integration
3.2 Techniken des Drei-Phasenmodell
3.2.1 Erste Technik: Placement
3.2.2 Zweite Technik: Layering
3.2.3 Dritte Technik: Integration
3.3 Internetbasierte Techniken
4 Geldwäsche und ihre Auswirkungen
5 Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland
6 Fazit
Literaturverzeichnis