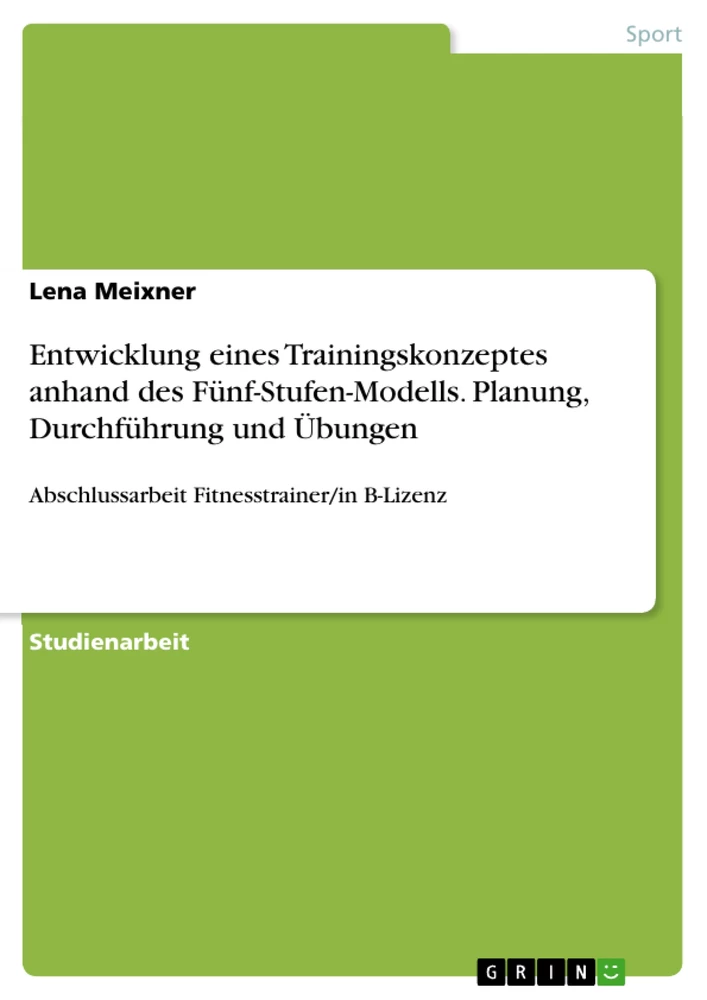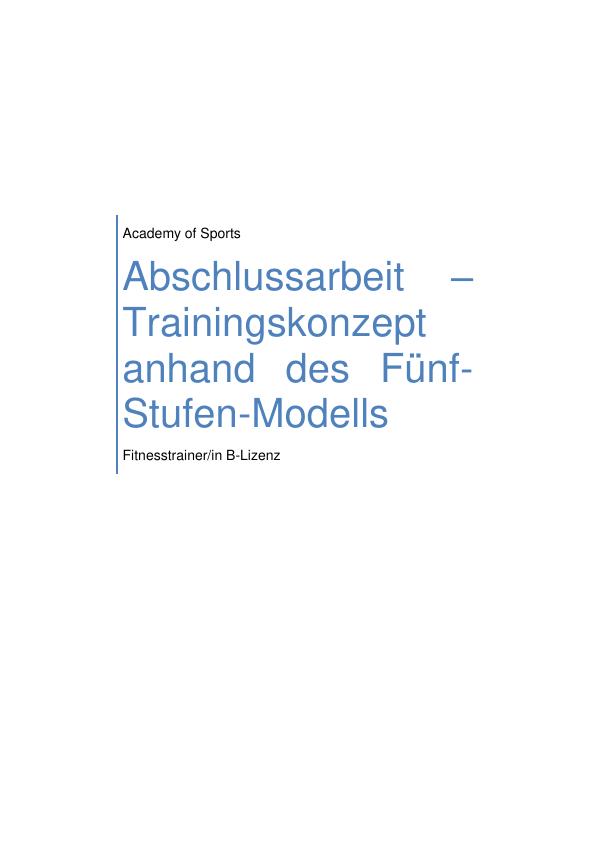In der vorliegenden Abschlussarbeit soll ein Trainingskonzept anhand des Fünf-Stufen Modells erarbeitet werden. Entsprechend dieses Modells ist die Arbeit aufgebaut: In Kapitel 2 wird zunächst die Person, für die dieses Konzept erstellt wurde, vorgestellt. Hierzu werden das Eingangsgespräch, biometrische Tests und auch motorische Tests dokumentiert.
Aufbauend auf den Informationen, die im Rahmen von Kapitel 2 gewonnen wurden, werden in Kapitel 3 die Ziele – bestehend aus Haupt- und Unterzielen – für das Training festgelegt. Im Anschluss kann in Kapitel 4 dann die eigentliche Trainingsplanung vorgenommen werden. Hierzu wird die Trainingsmethodik festgelegt, sowie eine Periodisierung und Zyklisierung eingeplant. Die verschiedenen Trainingszyklen werden hier sozusagen bis ins kleinste Detail (Aufbau einer einzelnen Trainingseinheit) ausgearbeitet.
In Kapitel 5 wird dann die eigentliche Durchführung des zuvor geplanten Trainings dokumentiert, um direkt im Anschluss in Kapitel 6 die Trainingsdurchführung und deren Ergebnisse zu analysieren und zu evaluieren.
Der Schlussteil, mit einem entsprechenden Fazit in Kapitel 7, soll die vorliegende Arbeit dann abrunden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Diagnose
1.1 Eingangsgespräch
1.2 Biometrische Tests
1.3 Motorische Tests
1.4.1 Beweglichkeitstests
1.4.2 Krafttests
3. Zielsetzung
4. Trainingsplanung
4.1 Trainingsmethodik
4.2 Periodisierung und Zyklisierung
4.2.1 Einteilung des Training ins Makro-, Meso- und Mikrozyklus
4.2.2 Aufbau des Mikrozyklus
5. Durchführung
6. Analyse und Evaluation
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
9. Anhang: Schmerzskala mit W-Fragen-Katalog
10. Anhang: Trainingsplan als Handout
11. Übungskatalog