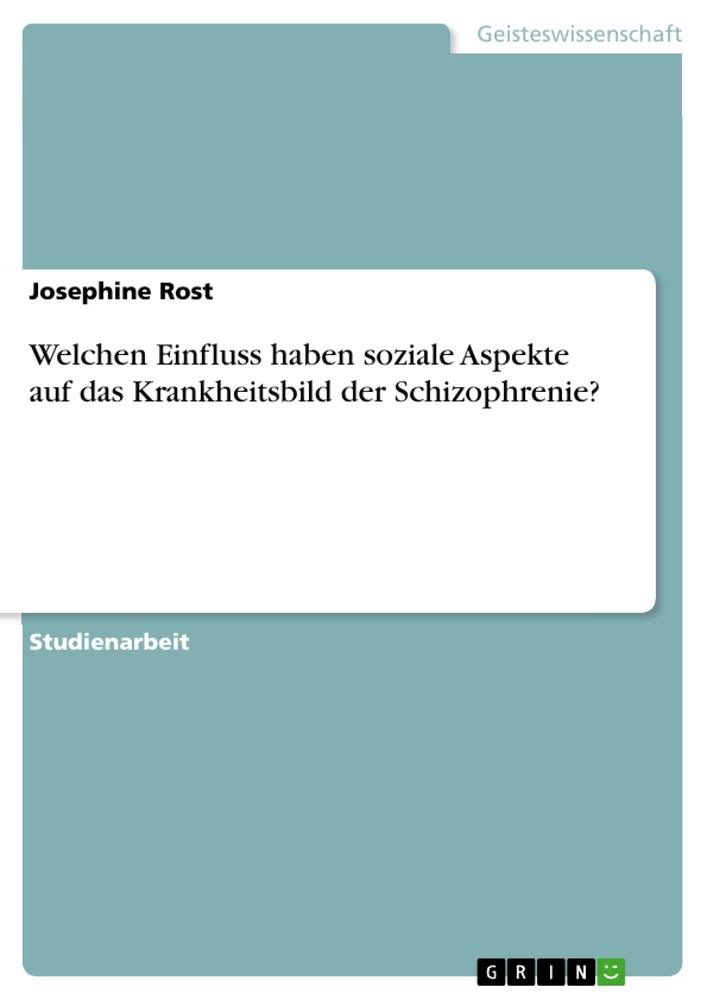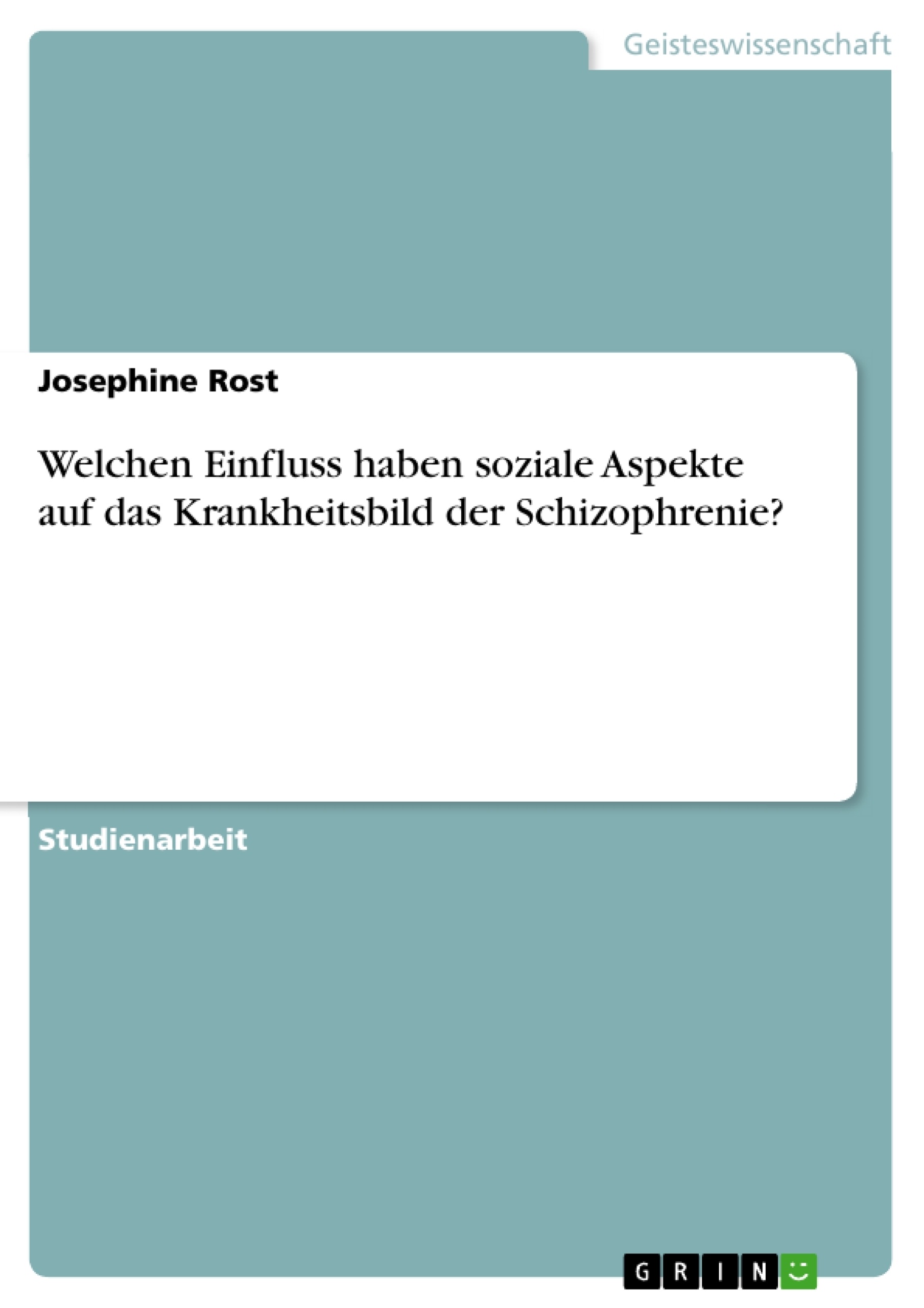Übersetzt man den Begriff „Schizophrenie“ wortwörtlich, kann dies zu Missverständnissen führen. Schizo (griechisch) bedeutet Spalt oder gespalten; Phrenos (ebenfalls griechisch) wird mit Geist oder Bewusstsein übersetzt. Wortwörtlich heißt Schizophrenie folglich „gespaltenes Bewusstsein“ beziehungsweise „gespaltener Geist“.
Gerade wegen dieser Bedeutung kommt es in der Öffentlichkeit des Öfteren zu einer Verwechslung mit der Krankheit der multiplen Persönlichkeit, obwohl die eine Krankheit mit der anderen rein gar nichts gemeinsam hat. Bei der Schizophrenie ist die Kognition und der Affekt gespalten, bei der Multiplen Persönlichkeit liegt eine Spaltung der Persönlichkeit – ein Wechsel von mehr als zwei unterschiedlichen Persönlichkeitszuständen – vor. Auch ich erlag dieser Verwechslung, als ich das erste Mal mit der Schizophrenie konfrontiert wurde. Ein Familienmitglied, mein Cousin, erkrankte an Schizophrenie. Er leidet nun seit 10 Jahren an dieser Krankheit, auch wenn er sich selbst für gesund hält.
In dieser Ausarbeitung möchte ich die sozialen Aspekte der Schizophrenie betrachten. Ich möchte herausfinden, welche Auswirkungen sozial relevante Einflussfaktoren – Geschlecht, Alter, Familienstand, sozioökonomischer Status, kritische Lebensereignisse, Einflüsse der näheren sozialen Umwelt und Drogenkonsum – auf die Krankheit bzw. ihr Entstehen haben und ob sich daraus eventuell Hilfestellungen für den Erkrankten ergeben. Die genetischen Ursachen möchte ich in dieser Arbeit außen vor lassen, denn erstens wäre dies ein Thema für eine eigene Arbeit und zweitens sind die genetischen Einflüsse nicht veränderbar. Außerdem bin ich der Ansicht, dass soziale Aspekte für Schizophrenie-Erkrankte von höherer Bedeutung sind, eben weil sie teilweise zu ändern sind. Ebenfalls nicht eingehen möchte ich auf die Therapiemöglichkeiten, die ebenfalls ein Thema für sich wären. Sie werden in dieser Arbeit nur sehr knapp angeschnitten.
Zunächst soll nun mit einem kurzen Einblick in die Schizophrenie begonnen werden. Nachdem anschließend am Beispiel meines Cousins die Symptome veranschaulicht werden sollen, wird es eine kurze Definition über die verschiedenen Typen der Schizophrenie geben. Daraufhin werden die sozial relevanten Einflussfaktoren auf ihre Auswirkungen und eventuelle Hilfestellungen untersucht, um die Ergebnisse abschließend am Beispiel meines Cousins zusammenzufassen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Was ist Schizophrenie?
2.1 Ein Fallbeispiel
2.2 Definition
2.2.1 Das Konzept der Subtypisierung
2.2.1.1 Paranoide Schizophrenie
2.2.1.2 Hebephrene Schizophrenie
2.2.1.3 Katatone Schizophrenie
2.2.1.4 Undifferenzierte Schizophrenie
2.2.1.5 Postschizophrene Depression
2.2.1.6 Schizophrenes Residuum
2.2.1.7 Schizophrenia Simplex
2.2.2 Das Positiv-Negativ-Konzept
2.2.2.1 Positiv-Symptome
2.2.2.2 Negativ-Symptome
3. Sozial relevante Einflussfaktoren
3.1 Geschlecht und Alter
3.2 Familienstand
3.3 Sozioökonomischer Status
3.4 Kritische Lebensereignisse
3.5 Einflüsse der näheren sozialen Umwelt
3.6 Drogenkonsum
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis